Die Fernsehtechnik
Hätte Thomas Alva Edison seinerzeit nicht die Glühlampe erfunden, hätte es vielleicht ein anderer getan. Und dennoch ist dem US-amerikanischen Erfinder und Unternehmer nicht nur die Markteinführung des elektrischen Lichtes zu verdanken. Die Ergebnisse seiner industriellen Forschung in den Bereichen Elektrizität und Elektrotechnik sind letztlich die Basis für die heutige Telekommunikation sowie die modernen Medien für Ton und Bild.
Edison entdeckte zum Ende des 19. Jahrhunderts die Glühemission im Zusammenhang mit einer geheizten Glühkathode im Vakuum eines Glaskörpers. Der sogenannte Edison-Richardson-Effekt wurde vom englischen Physiker John Ambrose Fleming aufgegriffen, der sich im Jahre 1904 die Vakuum-Diode patentieren ließ. Nur zwei Jahre später meldete der österreichische Physiker Robert von Lieben seine quecksilberdampfgefüllte Liebenröhre als Kathodenstrahlrelais zur Verstärkung des elektrischen Signals mit zwei Elektroden beim Kaiserlichen Patentamt an.
Im Gegensatz zur Liebenröhre verfügte die ebenfalls gasgefüllte Audionröhre des US-amerikanischen Erfinders Lee de Forest bereits über drei Elektroden. Im Oktober 1912 stellte De Forest seinen Röhrenverstärker der Firma Bell Telephone Laboratories vor. Schon ein Jahr später war diese Technologie markttauglich. Anstatt der Gasfüllung wurde in den Röhren nunmehr ein Hochvakuum erzeugt, die ab 1913 für Telefonverbindungen zwischen New York und Baltimore genutzt wurden. Auch in Österreich stellte Robert von Lieben seine gasgefüllten Röhren auf Vakuumröhren um. 1916 entwickelte der deutsche Physiker und Elektrotechniker Walter Schottky bei Siemens & Halske die Schirmgitterröhre (Tetrode), die sich allerdings wie auch die Pentode nur als Verstärker für den Niederfrequenzbereich eignete.
Für den Hochfrequenzbereich wurde im selben Jahr bei der englischen Marconi Company die Hochfrequenztriode V24 entwickelt – unter der Führung des englischen Forschers Henry Joseph Round, der ebenfalls als Erfinder der Leuchtdiode gilt. Mit der voranschreitenden Entwicklung der UKW- und Fernsehempfänger setzten sich letztlich die Trioden durch, die ihrem Namen nach aus drei Bauteilen bestehen: der Kathode (negative Elektrode) und der Anode (positive Elektrode) sowie dem Steuergitter, das sich dazwischen befindet.
In Deutschland revolutionierten Manfred von Ardenne und Siegmund Loewe im Jahre 1926 die Röhrentechnologie durch die Entwicklung der Dreifachröhre (3NF), die im Radioempfänger OE333 der Firma Loewe ihren Einsatz fand. Diese Mehrsystemröhre enthielt neben drei Trioden-Systemen auch zwei Kondensatoren und vier Widerstände.
Bis in die späten 1950er Jahre wurden in Rundfunk- und Fernsehempfängern ausschließlich Elektronenröhren verwendet, die allerdings zunehmend durch Transistoren ersetzt wurden. Erst mit der Jahrtausendwende verschwanden Röhren und Transistoren aus den Geräten der Unterhaltungselektronik. Heute stehen (fast) ausnahmslos LCD-/OLED-Flachbildschirme zur Verfügung. Die Plasma-Geräte sind bereits wieder vom Markt verschwunden. Nach diesem kleinen Exkurs in die Ursprünge der Bildübertragung sollen nun die technischen Grundlagen erörtert werden.
Bildübertragung
Neben individuellen Präferenzen sind doch allgemeinhin die Anforderungen an Bildwiedergabesysteme bis heute dieselben geblieben. Ein Bildwiedergabewandler (z.B. Fernseher) soll bei geringem Leistungsbedarf über eine hohe Helligkeit und Auflösung, kleine Trägheit, einen großen Betrachtungswinkel und natürlich eine große Bilddiagonale verfügen. Mit der modernen HDTV-Technologie sind Displays mit Bildschirmdiagonalen von einem Meter und darüber hinaus keine Seltenheit mehr. Auch Großbildprojektionen im Heimkinobereich finden immer mehr Verwendung.
Allen gemeinsam ist das Grundprinzip: die Rekonstruktion des auf der Aufnahmeseite erzeugten Bildes und die Umsetzung des Videosignals in sichtbares Licht. Grundsätzlich lassen sich Wiedergabewandler in aktive (emittierende) und passive (nicht emittierende) Systeme unterteilen.
Im 21. Jahrhundert haben wir uns längst an die leichten und flachen LCD- oder aber QLED- und OLED-Displays gewöhnt. Obwohl diese Technologien noch gar nicht so alt sind – vor allem wenn man bedenkt, dass knapp einhundert Jahre lang die Kathodenstrahlröhre unter anderem die Unterhaltungselektronik dominierte. Deshalb soll im Folgenden dieses einstige Wunderwerk der Technik gebührend erläutert werden.
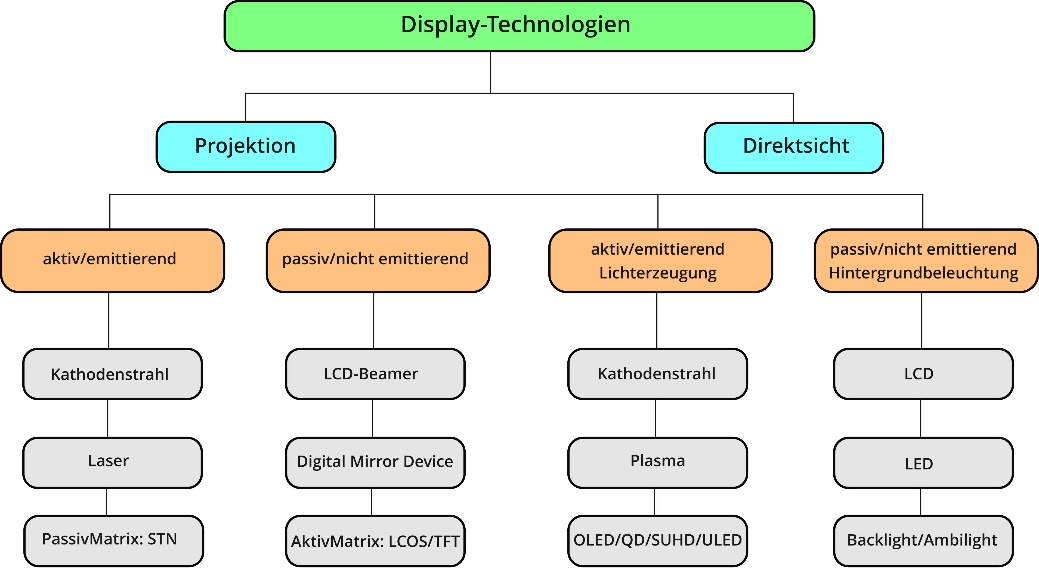
Displaytechnologien im Vergleich
Kathodenstrahl/Elektronenstrahl
Eine Kathode (griechisch: káthodos = Hinabweg) ist die Gegenelektrode zur Anode (griechisch: ánodos = Aufweg). Es handelt sich dabei um eine Elektrode, an der Elektronen einem System zugeführt werden, das beispielsweise aus einem Vakuum (Elektronenröhre) besteht. Zwischen diesen Elektroden wandern Ionen (griechisch: Ión = wanderndes Teilchen); die Kationen zur Kathode und die Anionen zur Anode.
Bereits zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden Kathodenstrahlen systematisch untersucht. Der österreichisch-ungarische Physiker Philipp Eduard Anton Lenard entwickelte im Rahmen seiner Untersuchungen das sogenannte Lenard-Fenster und bewies damit, dass Kathodenstrahlen in der Lage sind, eine Metallfolie, die aus mehreren Tausend Atomschichten besteht, zu durchqueren. Darüber hinaus erkannte Lenard, dass Kathodenstrahlen photographische Platten belichten und unter gewissen Umständen Phosphoreszenz hervorrufen können. Im Jahre 1905 wurde Lenard dafür mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Allerdings war seinerzeit noch nicht bekannt, dass die Kathodenstrahlen auf Elektronen zurückzuführen sind. Deshalb wird in diesem Zusammenhang sowohl der Begriff Kathodenstrahl als auch Elektronenstrahl verwendet. In einer Kathodenstrahlröhre beziehungsweise Elektronenstrahlröhre (z.B. Braun‘sche Röhre) werden technisch Strahlenbündel mithilfe eines Strahlensystems (Elektronenkanone) erzeugt, Elektronen aus einer Glühkathode freigesetzt und durch ein elektrisches Feld beschleunigt.
Elektronenröhre (Kathodenstrahlröhre)
Die Kathodenstrahlröhre (engl. cathode ray tube/CRT) wird nach ihrem Erfinder15 auch Braun'sche Röhre genannt. Obwohl Braun eigentlich auf dem Gebiet der drahtlosen Telegrafie seinen Nobelpreis erhielt und mit dem einst durch den Kölner Schokoladenproduzenten Ludwig Stollwerck gegründeten Konsortium „Professor Braun’s Telegraphie Gesellschaft GmbH“ (der späteren Telefunken AG) finanziellen Erfolg hatte, verdankt er seine Bekanntheit grundsätzlich der Erfindung seiner Kathodenstrahlröhre. Da Brauns wissenschaftliche Untersuchungen in eine andere Richtung gingen, betrachtete er seine Erfindung für die seinerzeit noch ganz junge Fernsehtechnik als ungeeignet. Erst Manfred von Ardenne benutzte am 14. Dezember 1930 die Braun’sche Röhre bei der ersten vollelektronischen Fernsehübertragung.
Aufbau
Im Laufe der sich entwickelnden Fernsehtechnik wurde aus der Braun’schen Kathodenstrahlröhre die Hochvakuumröhre, wie wir sie heute (im 21. Jahrhundert) allerdings überwiegend nur noch aus dem Museum kennen.
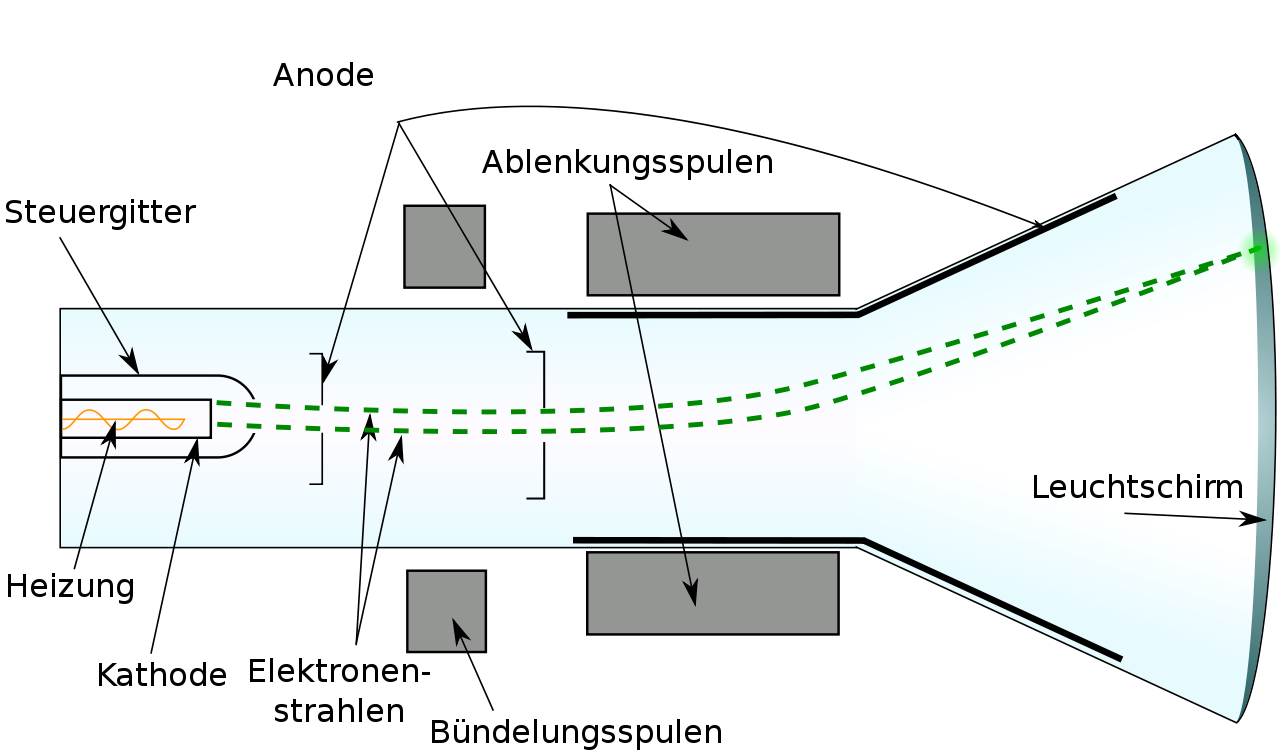
Schema der magnetischen Ablenkung bei der Kathodenstrahlröhre
Ähnlich wie Glühlampen bestehen Kathodenstrahlröhren aus geschlossenen, sogenannten evakuierten Glaskolben. Allerdings ist das Glas hier sehr viel dicker, um dem hohen Außendruck standhalten zu können. Je breiter die Fläche, desto höher der Druck. Wenn man von ca. 1 bar ausgeht, entspricht das ungefähr einem Druck von 1 kg/cm2. Deshalb müssen größere Geräte auch eine entsprechend dickere Glaskolbenwandung haben. Das Innere ist luftleer, es befindet sich also ein Vakuum im Glaskolben, damit der Elektronenstrom nicht von Luftmolekülen behindert wird.
Die Elektronen werden erzeugt, indem eine Metallfläche (Kathode) mit einem Glühdraht erhitzt wird. Die Wärme oder auch thermische Energie, die dabei entsteht, macht es möglich, dass die Elektronen aus der Kathode austreten. Der sogenannte Wehneltzylinder mit negativem Potential umgibt die Kathode, wobei an der Seite, die zum Bildschirm zeigt, ein kleines Loch dafür sorgt, dass der Elektronenstrahl austreten kann. Über die Spannungsdifferenz zwischen Kathode und Wehneltzylinder wird die Strahlungsintensität gesteuert, das heißt, dass der Elektronenstrahl nicht unmittelbar nach seiner Erzeugung sofort wieder auseinander driftet (divergiert).
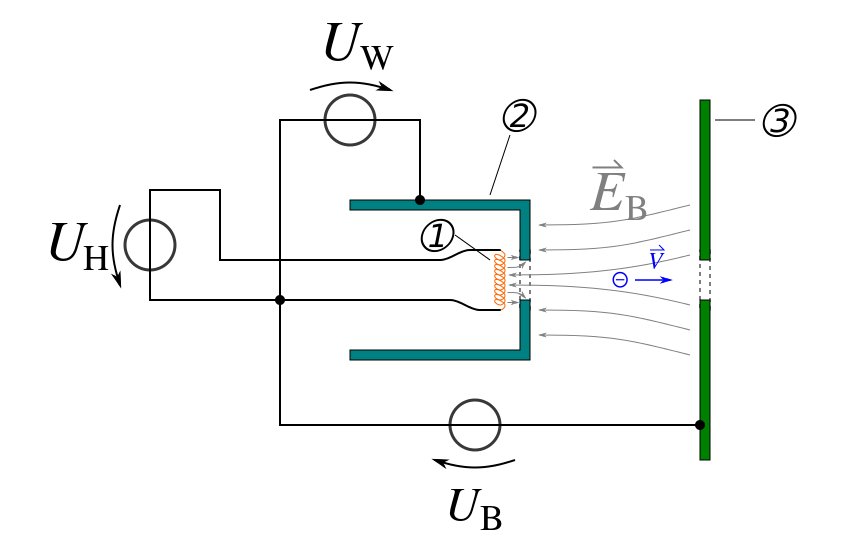
Aufbau einer Elektronenkanone mit Wehneltzylinder ➀ Glühkathode ➁ Wehneltzylinder ➂ Anodenblende
Wie bereits erwähnt, ist die Kathode die Gegenelektrode zur Anode. Diese besteht bei Kathodenstrahlröhren oft aus einer elektrisch leitenden Schicht an der Innenseite des konischen Glaskörpers und einem Zylinder, der direkt in der Strahlenbahn liegt. Bei Schwarz/Weiß-Röhren werden die Elektronen mit ungefähr 18 kV auf die Anode beschleunigt. Dabei gelangen sie in den Bereich der sogenannten Fokussierelektroden, die für die Bildschärfe verantwortlich sind. Hier wird ein elektrisches Feld erzeugt, das den Elektronenstrahl bündelt. Sobald die Elektronen die Anode passiert haben, „fliegen“ die Elektronen bei konstanter Geschwindigkeit bis zur Leuchtschicht weiter. Dabei werden die Leuchtstoffe (Phosphore) zur Lichtemission angeregt. Diese erfolgt ungerichtet, weshalb bei der Betrachtung eines Röhrenbildschirms die Blickrichtung relativ unabhängig ist.
Je schneller der Elektronenstrahl, desto höher die Leuchtdichte. Dies gilt es zu vermeiden: Denn bei großem Strahlstrom würde sich auch der Elektronenstrahldurchmesser erhöhen, was wiederum eine verringerte Bildschirmauflösung zur Folge hätte. Deshalb wird die Strahlstromstärke relativ gering gehalten (unter 1 mA). Auch die Beschleunigungsspannungen am Anodenanschluss liegen unterhalb von 30 kV. Wären die Elektronen zu schnell, würden sie beim Auftreffen auf die Leuchtschicht beziehungsweise die Glaskolbenwand so stark abgebremst werden, dass eine ungewollte Röntgenstrahlung entstünde.

9″-Schwarz-Weiß-Bildröhre mit zugehöriger Ablenkeinheit
Der Leuchtschirm besteht aus einer leitfähigen Schicht und ist mit einer dünnen Aluminiumschicht hinterlegt. Damit ist zum einen möglich, dass die Elektronen zur Anode abfließen können und sich damit der Stromkreis schließt. Zum anderen werden durch den aluminiumhinterlegten Leuchtschirm die Sekundärelektronen abgeleitet, welche dabei entstehen, wenn der Elektronenstrahl auf die Leuchtschicht trifft. Darüber hinaus reflektiert diese das Licht, damit die Leuchtstoffe in den Röhreninnenraum abstrahlen können. Infolgedessen wird sowohl die Bildhelligkeit als auch gleichzeitig der Kontrast erhöht. Letzterer wird auch durch die Verwendung von Grauglas gesteigert, das zumeist für die Herstellung der Röhren verwendet wurde.
Von außen ist der Glaskolben am konischen Teil oft mit einer dünnen Graphitschicht überzogen. Die Erdung dieser Schicht bewirkt, dass das Gerät vor Ladungsausgleichen geschützt ist (Faradayscher Käfig). Gemeinsam mit der inneren Anodenbeschichtung wirkt die äußere Grafitschicht wie ein Kondensator, der die Anodenspannung „glättet“. Mit diesem Grafitbelag sind elektrisch leitende Gitter verbunden. So kann der dadurch entstehende elektrische Widerstand die hohe Anodenspannung (bis 27 kV) auf geringere positive Potenziale senken.
Strahlablenkung
Für eine zweidimensionale Bilddarstellung muss der gebündelte Elektronenstrahl sowohl vertikal als auch horizontal abgelenkt werden. Diese Strahlablenkung kann entweder durch elektrische oder magnetische Felder erfolgen.
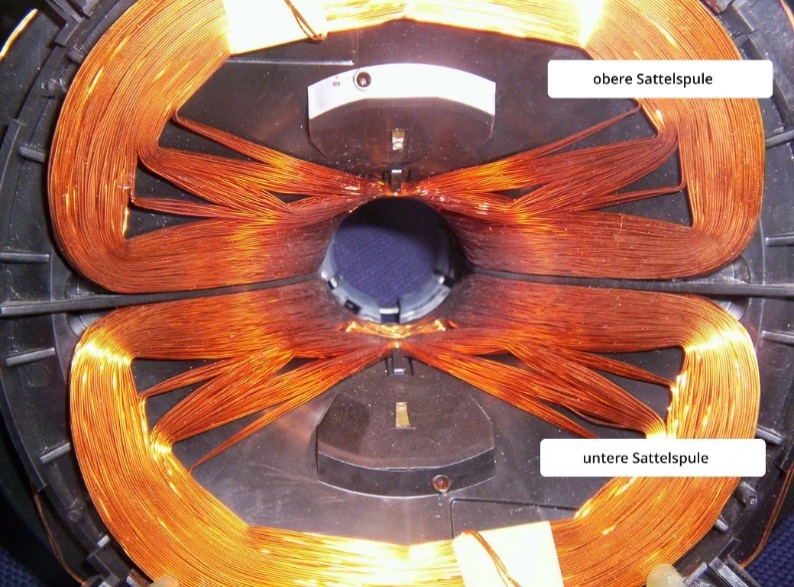
Ablenksystem / Horizontalablenkspulen einer Fernseh-Bildröhre
Da Fernseh- und Monitorröhren in der Regel einen großen Bildschirm und einen kurzen Röhrenhals haben, ist es notwendig, den relativ kurzen Elektronenstrahl in einem breiten Winkel zu streuen. Dazu dienen starke magnetische Felder, die zum einen durch zwei verschiedene Spulensysteme auf einem gemeinsamen Ferritkörper erzeugt werden. Diese Spulenanordnung ist auf dem Röhrenhals angebracht (vgl. Abbildung).
Während der Ablenkung ist der Stromverlauf annähernd sägezahnförmig, das heißt, dass die Frequenzen sehr kurz und damit die Amplituden spitz zulaufen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
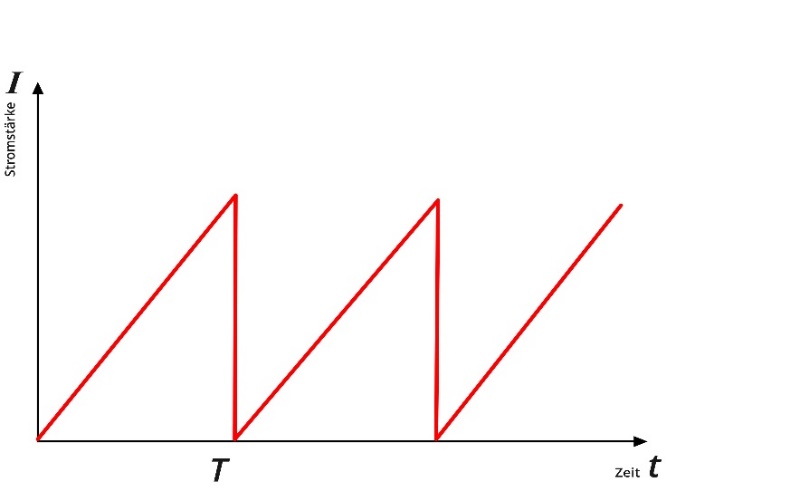
Schematische Darstellung einer Sägezahnspannung
Während der aktiven Zeilendauer wird der Elektronenstrahl durch die innenliegenden Sattelspulen von links nach rechts über den Leuchtschirm geführt (Horizontalablenkung). Dabei steht ihr Magnetfeld senkrecht zur Ablenkrichtung. Die Vertikalablenkung erfolgt nach demselben Prinzip durch das Magnetfeld, welches durch die Toroid- oder Ringspulen erzeugt wird. Sie liegen unterhalb der Sattelspulen und sind um den Ferritkern gewickelt. In der sogenannten Austastlücke springt der Strahl – für das menschliche Auge unsichtbar – an seinen Ausgangspunkt zurück. Das sogenannte Zeilensprungverfahren wird im Kapitel „Bildabtastung“ noch eingehender erläutert.
Comeback der Bildröhre?
Die Firma Samsung hat im Jahre 2014 tatsächlich einen neuen Versuch gestartet und ihren Röhrenfernseher Vixlim (ein Kunstwort aus "Victory" und "Slim") vorgestellt. Dem koreanischen Unternehmen war es seinerzeit gelungen, den Ablenkwinkel auf 125 Grad zu erhöhen, sodass der Elektronenstrahl über kürzere Wege die gesamte 32 Zoll (81 Zentimeter) große Bildfläche erreicht. Doch damit nicht genug. Im Gegensatz zu dem bisherigen Manko der Röhrenfernseher – den gewaltigen Geräteproportionen – gelang es Samsung mithilfe moderner Computertechnik, ein relativ schmales Design herzustellen. Die Bildröhre des Vixlim war nun nicht mehr wie bisher 60 Zentimeter, sondern nur noch magere 35 Zentimeter tief. Dazu musste die herkömmliche Form des Glaskörpers der Röhre von Grund auf neu konzipiert werden.

HD ready Röhren-TV von Samsung WS-32Z409T
Im Jahre 2006 machte Samsung für seine HD-fähige Röhre (WS-32Z409T) auf der CeBIT Werbung und stellte dort den ersten Röhrenfernseher vor, der in der Lage war, HDTV-Standards 720p und 1080i sowohl mit 50 Hz als auch 60 Hz darzustellen.
Dennoch waren der Stromverbrauch und die Geräteabmessungen sowie das Gewicht für die Verbraucher ausschlaggebend. Deshalb scheiterte der Versuch, die Röhre ein letztes Mal zu „reanimieren“. Auch wenn die Herstellung der Röhrenfernseher in der Regel preiswerter war, konnte sich die neue-alte Technologie (jedenfalls in Europa) nicht durchsetzen. Die klobige Glotze und damit das Vermächtnis von Nipkow, Braun, Ardenne & Co. wanderte ins Museum oder auf den Sperrmüll. Doch gehen wir gemeinsam noch einmal einen Schritt zurück. Wie war das damals, als das Fernsehen bunt wurde?
Farbbildwiedergabe
Der deutsche Fernsehpionier Werner Flechsig ließ sich im Juli 1938 seine Erfindung mit dem Titel „Kathodenstrahlröhre zur Erzeugung mehrfarbiger Bilder auf einem Leuchtschirm“ vom Deutschen Reichspatent patentieren. Sie funktionierte nach dem Grundprinzip zur Erzeugung farbiger Bilder mit Schattenmasken-Bildröhren. Allerdings geriet die technische Umsetzung durch den 2. Weltkrieg ins Stocken und musste letztlich ganz eingestellt werden. Die Radio Corporation of America begann im Jahre 1949 mit der kommerziellen Realisierung dieses Patentes, das als erstes seiner Art die additive Farbmischung mit drei Grundfarben zur Erzeugung aller Farben beinhaltete.
Loch- und Schlitzmaskenröhre
Für die drei Grundfarben (Rot, Grün, Blau) werden in Farbbildröhren jeweils Leuchtstoffe (Farbstoffphosphore) verwendet, die in diesen drei Farben leuchten. In kleinen Strukturen werden diese sehr eng beieinander angeordnet, wobei jeder Bildpunkt aus drei Pixeln (Farbtripel) besteht, die das Licht der jeweiligen Farbe durchlassen. Durch die additive Farbmischung wird die Farbe der einzelnen Bildpunkte erreicht. Für die „Erregung“ der Farbstoffphosphore von drei Grundfarben werden nunmehr auch drei Elektronenstrahlquellen benötigt. Diese Elektronenkanonen sind im Hals der Bildröhre entweder nebeneinander oder im Dreieck angeordnet (Dreistrahlröhre). Das Prinzip der Ablenkspulen findet auch hier seine Anwendung. Mit dessen Hilfe ist es möglich, dass die (drei) Elektronenstrahlen in 1/25 Sekunden (PAL, SECAM) oder 1/30 Sekunden (NTSC) den gesamten Bildschirm Zeile für Zeile abtasten können.
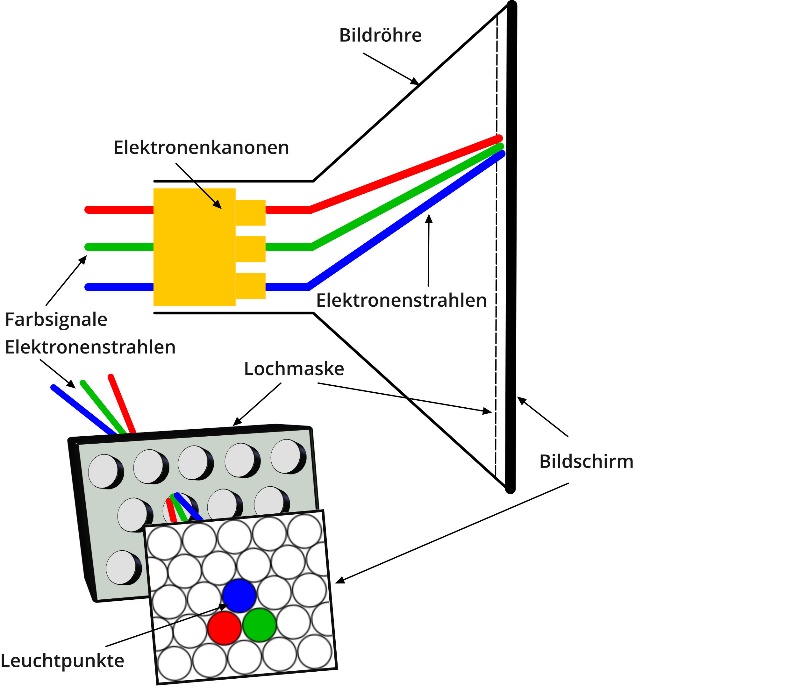
Schematische Darstellung einer Kathodenstrahlröhre mit Lochmaske
Die Herausforderung besteht nun darin, dass jeder der drei Elektronenstrahlen auch „seine“ Farbe findet. Dazu dienen sogenannte Schattenmasken, die sich in einem fest definierten Abstand zirka 15 Millimeter vor dem Leuchtschirm befinden. Hier kreuzen sich die drei Strahlen in jeder Position auf der Ebene der Maske und lassen jeweils nur die „richtigen“ Elektronen durch. Diese Maske besteht aus einem dünnen Blech, das ein regelmäßiges Muster punkt- oder schlitzförmiger Löcher (Loch- oder Schlitzmaske) aufweist oder aus vertikalen Streifen besteht (Trinitron-Bildröhre). Das Raster der Schattenmaske ist so konzipiert, dass der Fernseher verschiedene Fernsehnormen (vgl. Kapitel „Fernsehnormen“) anzeigen kann - also unabhängig von der Zeilenzahl und der horizontalen Auflösung.
Delta-Farbbildröhre (Lochmaske)
Bei der Lochmaske handelt es sich um die älteste Farbbildröhre, die ihren Einsatz in der Praxis fand. Vor allem Computermonitore sind beziehungsweise waren mit dieser Art der Farbbildröhre ausgestattet. Der Name „Delta“ steht für die Anordnung des Strahlsystems, das einem gleichseitigen Dreieck und damit dem griechischen Buchstaben Δ ähnelt. Entsprechend der Strahlungserzeugungsanordnung sind auch die Farbtripel in einem solchen Dreieck angeordnet (vgl. Abbildung).
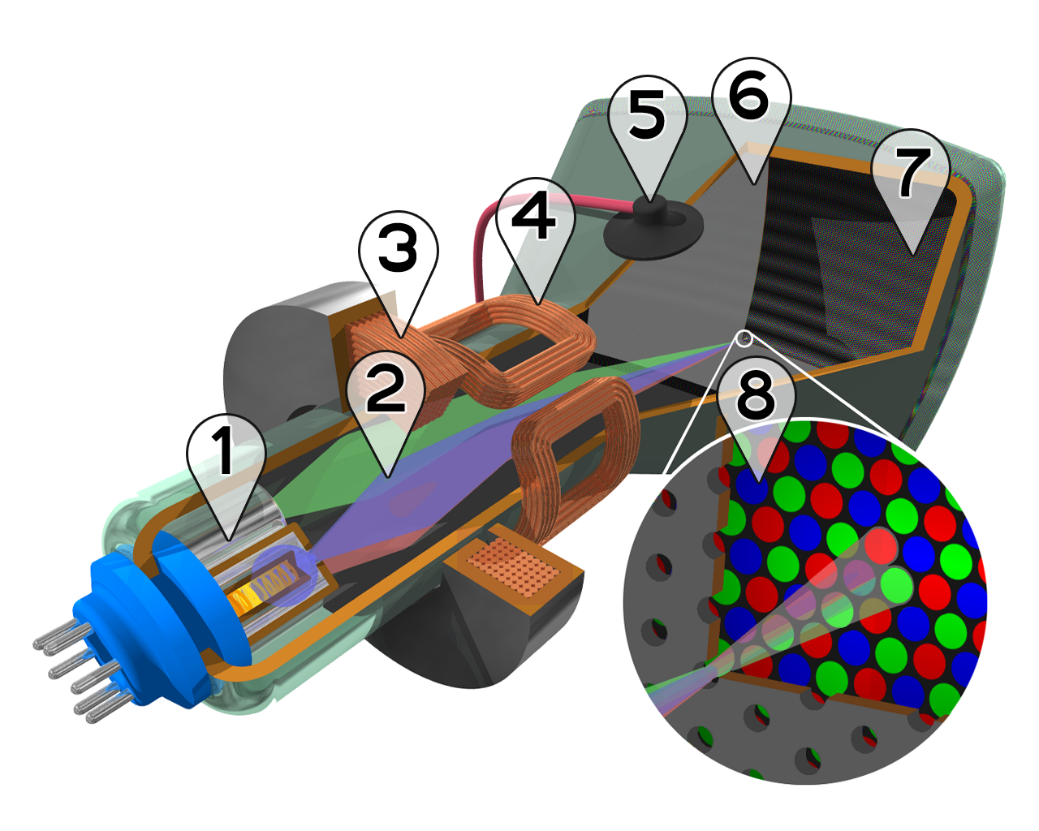
Aufbau einer Lochmasken-Bildröhre
1. Glühkathoden, 2. Elektronenstrahlen, 3. Bündelungsspulen, 4. Ablenkspulen, 5. Anodenanschluss, 6. Lochmaske, 7. Fluoreszenzschicht mit
roten, grünen und blauen Subpixeln, 8. Nahansicht der Fluoreszenzschicht
Damit sich die Strahlen auch tatsächlich in dem jeweiligen Loch der Maske treffen, ist der Lochdurchmesser (zirka 0,2 Millimeter) etwas kleiner als der Durchmesser der Farbstrahlen und Leuchtpunkte, der jeweils etwa 0,3 Millimeter beträgt. Der Schnittpunkt der drei Strahlen (Rot, Grün, Blau) liegt in dem jeweiligen Loch der Maske, weshalb sie auch Lochmaske genannt wird. Bei typischen Farbbildröhren mit einer Bildschirmdiagonale von 60 Zentimetern beträgt die Anzahl der Löcher einer Maske ca. 400.000 und der Abstand zwischen zwei Leuchtpunkten einer Reihe (Pitch) ungefähr 0,7 Millimeter.
Aufgrund der sehr dicht liegenden Farbtriple verfügt die Delta-Lochmasken-Farbbildröhre über eine relativ hohe Bildauflösung. Allerdings sind umfangreichere Korrekturschaltungen mithilfe von Zusatzspulen nötig, um eine ausreichende Konvergenz (exakte Kreuzung der Strahlen im Maskenloch) zu erzielen. Auch die geringe Maskentransparenz (ca. 17 Prozent) ist ein Nachteil gegenüber Schlitz- und Streifenmasken, da ein Großteil der Elektronen ungenutzt auf der Maske landet. Dennoch überzeugte die Darstellungsqualität, sodass insbesondere im professionellen Bereich der Computertechnik (z.B. Medizin) die hochauflösenden Monitore mit einer Delta-Farbbildröhre umfangreiche Verwendung fanden. Im Laufe der Zeit wurden mit immer exakter funktionierenden Ablenkspulensystemen die technischen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Konvergenz nahezu behoben.
Inline-Farbbildröhre (Schlitzmaske)
Mitte der 1970er Jahre wurde ein weiterer Farbbildröhrentyp entwickelt, der das Problem der präzisen Konvergenzeinstellungen vereinfachen sollte. Mit fortschreitender technischer Entwicklung war es möglich, die Strahlerzeugungssysteme zu verkleinern und damit gleichzeitig den Durchmesser des Bildröhrenhalses zu verringern. Deshalb konnten die Strahlerzeugungssysteme nicht mehr als Delta angeordnet werden, sondern nunmehr nebeneinanderliegend in einer In-Line-Anordnung.
Aufgrund der größeren Schlitze in der Maske waren weitaus weniger Korrekturmaßnahmen nötig, um eine genaue Strahlkonvergenz zu erreichen. Die Konvergenzfehler reduzierten sich von drei auf zwei Dimensionen. Im Umkehrschluss mussten die Ablenkeinheiten nicht mit demselben hohen Aufwand arbeiten, wie bei den Delta-Farbbildröhren.
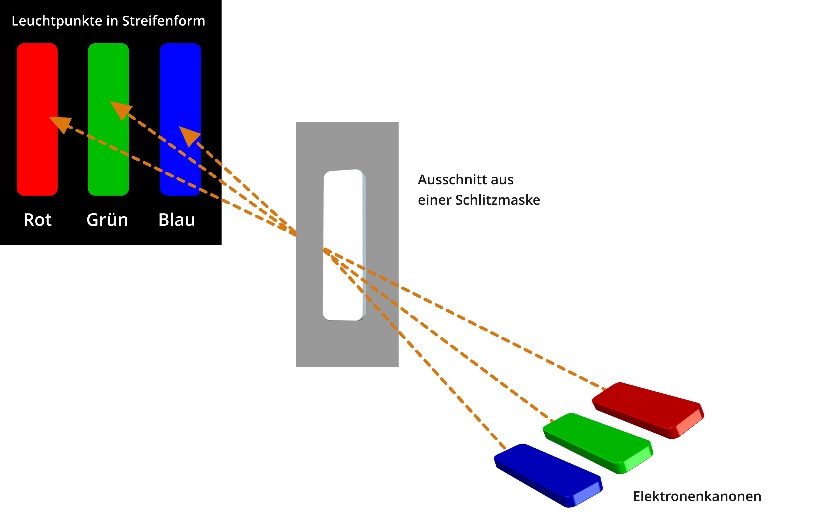
Schematischer Verlauf der Elektronenstrahlen durch eine Schlitzmaske
Durch die Schlitze vergrößerte sich auch die offene Fläche der Maske, was zur Folge hatte, dass mehr Elektronen zur Leuchtschicht gelangen konnten (vgl. Abbildung). Deshalb lieferten die In-Line-Farbbildröhren auch bei herkömmlichem Strahlstrom ein helleres Bild als die Delta-Röhren. Aufgrund des geringeren technischen Aufwandes avancierte dieser Typ zur Standardbildröhre in Fernsehgeräten. Später wurde aus der Inline-Röhre die Black-Matrix-Röhre, die zwar nach demselben Prinzip der Schlitzmaske arbeitete, jedoch kleine Veränderungen enthielt (z.B. lichtabsorbierendes Material), die den Kontrast aber auch die Farbreinheit verbesserten.
Trinitron-Röhre
Im April 1968 stellte das noch junge japanische Unternehmen Sony (1949 gegründet) eine neue Farbbildröhre vor. Diese unterschied sich grundsätzlich von der bis dahin gebräuchlichen Delta-Röhre. Im selben Jahr kamen die ersten Fernsehgeräte mit dieser neuen Technologie auf den Markt, deren Bildschirmdiagonale für damalige Verhältnisse stolze 33 Zentimeter betrug. Seither ist Sony einer der führenden Hersteller in dieser Branche.
Im Gegensatz zur Loch- oder Schlitzmaske sind hier die Leuchtstoffe in vertikaler Richtung nicht unterbrochen. Die Phosphore laufen als durchgehende Streifen senkrecht über den Bildschirm. Die Schattenmaske ist vielmehr ein Blendengitter, das ebenfalls aus senkrecht verlaufenden Streifen besteht, weshalb diese auch als Streifenmaske bezeichnet wird.

Sony Trinitron KV-1310 colour TV
Um die Maske zu stabilisieren, wurden die Streifen jeweils unter Spannung gesetzt. Darüber hinaus waren sie mit querverlaufenden dünnen Drähten fixiert, um Schwingungen zu vermeiden. Das Strahlsystem war wie bei der In-Line-Röhre in einer Reihe angeordnet. Die Maskentransparenz lag aufgrund der durchgehend verlaufenden Streifen bei ungefähr 22 Prozent und war damit von allen Farbbildröhren auf dem höchsten Niveau. Deshalb boten Trinitron-Röhren ein sehr helles Bild. Allerdings führten die relativ hohe Durchlässigkeit der Maske und die Anordnung der Leuchtstoffe zu einer schlechteren Auflösung, einem geringeren Kontrast und mitunter zu Alias- und Treppeneffekten an senkrechten Linien. Darüber hinaus war die mechanische Empfindlichkeit der fragilen Maskenkonstruktion mit ihren dünnen Drähten ein Problem, da sie vor allem bei Erschütterungen zu Schwingungen neigte, die zulasten der Bildqualität ging.
Insofern schaffte Sony mit dieser Technologie zwar nicht den Einstieg in den Markt der sogenannten CAD-Systeme, also im Anwendungsbereich der computerunterstützten Entwicklungs-, Entwurfs- und Konstruktionstechnik (Computer Aided Design: CAD). Jedoch konnte im Gegenzug auf die teure Technologie der Konvergenzeinheit umfassend verzichtet werden. Das ermöglichte erstmals die Produktion relativ simpel konstruierter Fernsehgeräte, die entsprechend preiswert auf den Markt gebracht werden konnten. Damit gelang Sony bis Ende der 1970er Jahre der Durchbruch auf dem entstehenden weltweiten Massenmarkt der Farbfernsehgeräte.
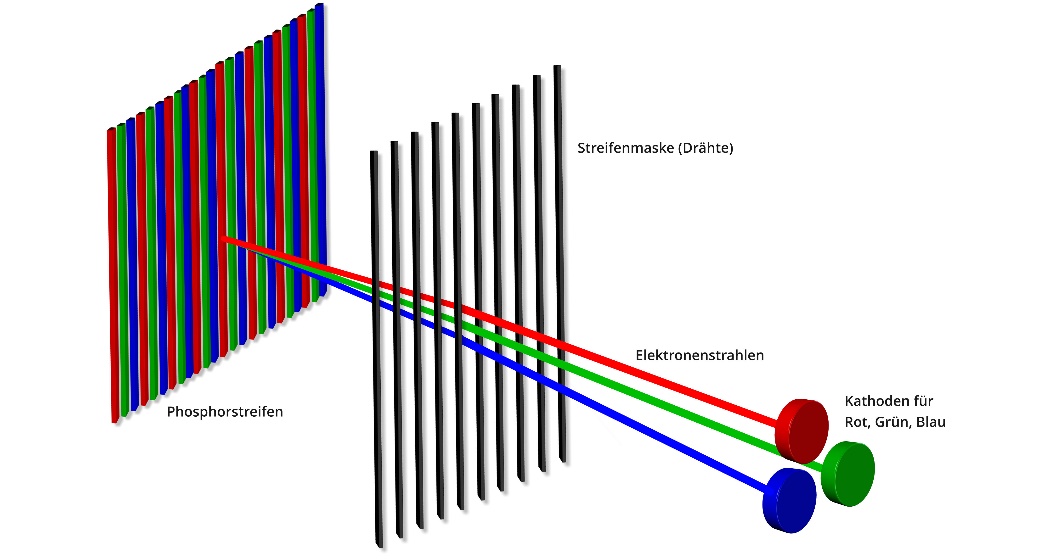
Abbildung 46: Streifenmaske (Trinitron-Röhre)
Bildaufbau
Die elektronische Übertragung von Bildern erfolgt durch Umwandlung elektrischer Signale und der Abbildung auf einer sogenannten Bildwandlerfläche. Dabei werden bei der Fernsehübertragung dieselben Basistechnologien verwendet wie beispielsweise beim Radio oder allgemeinhin bei der Funkübertragung (Telefon), da sowohl Bilder als auch Töne nichts anderes sind als elektromagnetische Wellen.
So werden bei der elektronischen Bildaufnahme und -wiedergabe einzelne Bildpunkte nacheinander und Zeile für Zeile durch den bereits beschriebenen Elektronenstrahl „abgetastet“. Anschließend wird jedes Bild in elektrische Signale zerlegt und als hochfrequente elektromagnetische Signale zu den einzelnen Empfängern übertragen. Dazu dient heute nicht nur die klassische Fernsehantenne, die Übertragung erfolgt darüber hinaus über Kabel, Satellit oder aber das IP-Signal. Im Bildempfänger werden die jeweiligen Signale wieder in Lichtpunkte umgewandelt, wie anhand des Prinzips der Kathodenstrahlröhre bereits beschrieben.
Auf der Leuchtschicht der jeweiligen Röhre wird das Bild nunmehr Punkt für Punkt zeilenförmig aufgebaut. Das klassische Fernsehbild besteht insofern aus Bildzeilen, die nacheinander „eingelesen“ werden. Die Frequenzen beziehungsweise die Geschwindigkeit des Bildaufbaus können dabei variieren, sind jedoch in jedem Fall so schnell, dass das menschliche Auge aufgrund seiner Trägheit weder die einzelnen Zeilen noch die separaten Bilder wahrnimmt, sondern den Film als Ganzes erkennt. Im Laufe der sich entwickelnden Fernsehtechnik haben sich verschiedene Normen und Bildübertragungsverfahren etabliert, die auf unterschiedliche Bildfrequenzen und -formate zurückgreifen. Hierauf wird im folgenden Kapitel noch gesondert eingegangen.
Gerade zu Beginn des Fernsehens war eine parallele Übertragung – also Bild für Bild – aufgrund geringer Speicherkapazitäten ineffizient. Auch heute noch werden Vollbilder teilweise in zwei Halbbildern dargestellt, die versetzt gesendet werden. In diesem Zusammenhang spricht man auch von einer räumlichen und zeitlichen Diskretisierung. Damit ist pauschal die Gewinnung einer Teilmenge aus einer kontinuierlichen Daten- oder Informationsmenge gemeint, die das Ziel hat, die Übertragung wirtschaftlicher beziehungsweise effizienter zu gestalten. Dabei werden die Bildpunktinformationen seriell statt parallel übertragen, was zur Folge hat, dass die Menge der Bildpunkte reduziert werden kann und damit eine schnellere Übertragung möglich ist.
Bildraten von 24 bis 120 Hz
Die klassische Methode zur Bildübertragung seit der Erfindung des Fernsehens bildet das sogenannte Zeilensprung- oder Halbbildverfahren. Dabei werden zwei Halbbilder (Abbildung 45) nacheinander und Zeile für Zeile gesendet und empfangen, wobei beim ersten Halbbild mit der ersten Bildzeile begonnen wird.
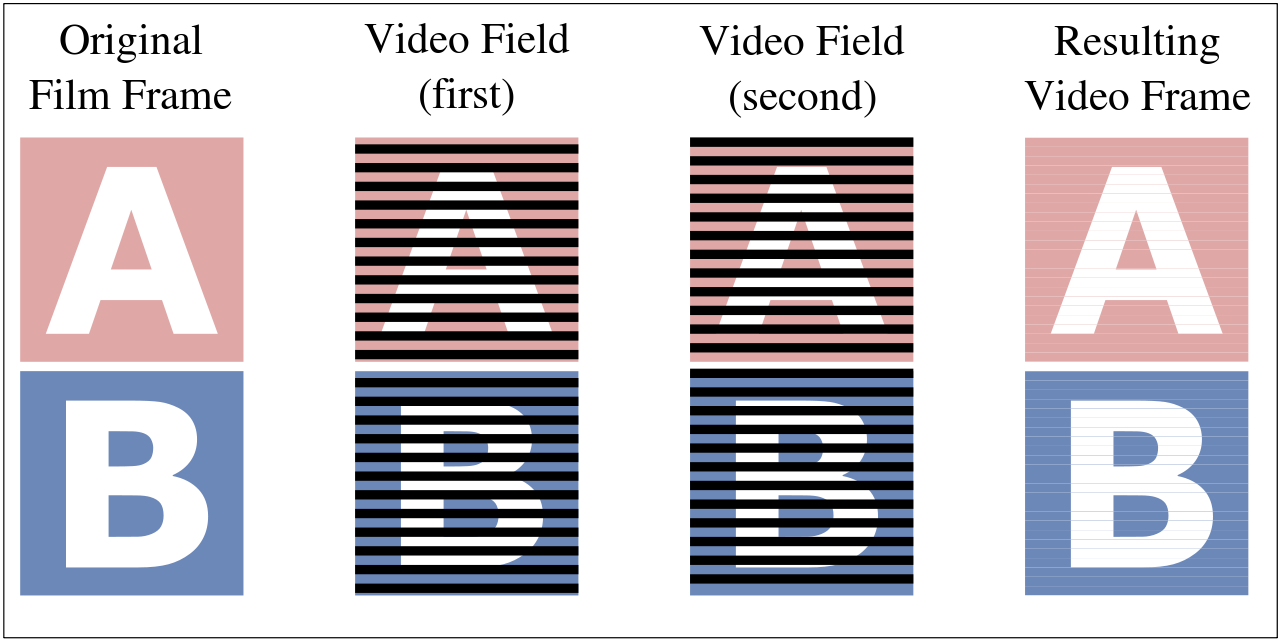
Halbbilder im Zeilensprungverfahren
Demnach erfolgt zuerst die Abtastung der ungeraden Zeilen und im Anschluss die der geraden Bildzeilen. Als zweite Variante der Bildübertragung entwickelte sich das Vollbildverfahren, bei dem die vollwertigen Bilder nacheinander übertragen werden. Als einer der wichtigsten Parameter des Videosignals ist deshalb die Bildwechselfrequenz zu betrachten, die auch als zeitliche Diskretisierung oder Zeitauflösung bezeichnet wird.
Damit der menschliche Gesichtssinn die bewegten Bilder als einen zusammenhängenden Bewegungsablauf erfassen kann, war seinerzeit die Frage zu klären, wie viele Bilder pro Sekunde übertragen werden müssen. Als die Fernsehtechnik noch in den Kinderschuhen steckte, wurde bereits mithilfe des Daumenkinos (vgl. Abbildung) festgestellt, dass mindestens 20 Bilder pro Sekunde ausreichend sind, damit unser Auge beziehungsweise unser Gehirn eine scheinbar gleichmäßige Bewegung wahrnimmt.
Bevor das Fernsehen Einzug in die heimischen Wohnzimmer hielt, waren Filme nur im Kino zu sehen. Hier wurden 24 (Voll-)Bilder pro Sekunde gezeigt, wie es auch heute noch im modernen Cinema grundsätzlich üblich ist.
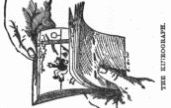
Der Kineograph im Jahre 1868
Allerdings ist dieser vermeintlich langsame Bildwechsel, der mit Dunkelpausen verbunden ist, für unsere Wahrnehmung mit einem erheblichen Kraftaufwand verbunden. Die rezeptiven Felder (vgl. Kapitel „Kontrast/Schärfe“) müssen permanent zwischen Erregung und Hemmung der Neuronen wechseln, was auf Dauer sehr anstrengend ist und als ein unangenehmes Flackern empfunden wird. Je schneller der Bildwechsel, desto geringer erscheint dieses Großflächenflimmern, bei dem das menschliche Auge auf alle Bildpunkte gleichzeitig reagieren muss. Erst ab einer Bildrate über 50 Hz (also mehr als 50 Bilder pro Sekunde) wird die sogenannte Flimmer-Verschmelzungsfrequenz erreicht, bei der diese für den Menschen unangenehme Erscheinung verschwindet.
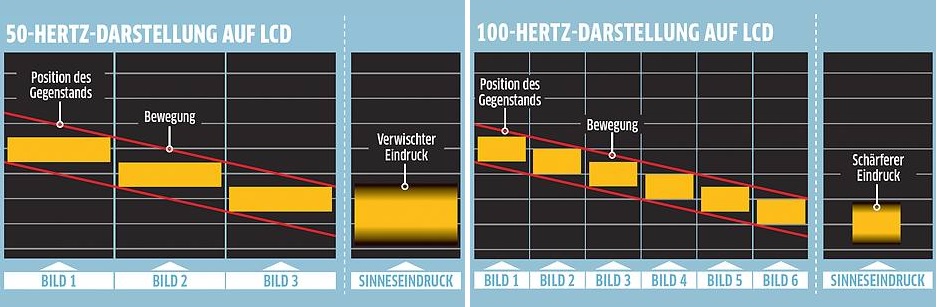
Unterschiedliche Wahrnehmung bei 50 Hz bzw. 100 Hz
Kino
Aber auch die Helligkeit des Bildes und der Blickwinkel sind ausschlaggebend für die Flimmerempfindlichkeit. Im Kino werden die Filmbilder deshalb in einem weitgehend abgedunkelten Umfeld zwei- oder dreimal projiziert. Daraus ergibt sich eine Verdopplung der Dunkelpausen bei einer Flimmerfrequenz von 48 Hz (doppelte Projektion) beziehungsweise 72 Hz (dreifache Projektion). Auch die Leuchtdichte der Kinoleinwand liegt unter 50 cd/m2, was die Helligkeit der Bildwiedergabe dimmt und damit die Flimmerempfindlichkeit verringert.
Gerade im Zusammenhang mit stereoskopischen Anwendungen (3D) wird mittlerweile empfohlen, die Bildwechselfrequenz in allen Formaten zu erhöhen. Kino- und Fernsehstandards sollten demnach mit 80, 100 oder sogar 120 Bildern pro Sekunde arbeiten, denn eine höhere Bildwiederholungsrate kann (gerade bei 3D-Filmen) die Qualität erheblich verbessern, da sie das Bildflimmern beziehungsweise -ruckeln und damit die Bewegungsunschärfe vermindert. Im Rahmen der Digitalisierung der Formate für Kinofilme (High Frame Rate: HFR/HFR 3D) etablierte sich Digital Cinema Initiatives (DCI) als entsprechender Standard.
In Deutschland wurde der erste Kinofilm im Jahre 2012 mit 48 Bildern pro Sekunde veröffentlicht (Der Hobbit). Die Fortsetzung von James Camerons „Avatar“, dessen Kinostart für 2017 vorgesehen ist, soll mit 60 Bildern pro Sekunde gedreht und projiziert werden. Dafür müssen die Kinos entsprechend auf Projektoren umrüsten, die die erforderlichen 96 beziehungsweise 120 Hz beherrschen. Der erste HFR-3D-Projektor mit 60 Bildern pro Sekunde wurde im Jahre 2013 im österreichischen Cinepoint in Tirol installiert.
Fernsehen
Im Laufe der Entwicklung der Fernsehtechnik erhöhte sich die Anzahl der Bildzeilen, bis sich schließlich zwei Werte etablierten. In Europa ergab sich schon allein aus der traditionellen Frequenz des Netzwechselstroms von 50 Hz eine Festlegung von 625 Zeilen pro Bild, was 25 Vollbildern in der Sekunde und damit einer Bildrate (Halbbilder) von 50 Hz entsprach (15.625 Zeilen pro Sekunde: PAL). Parallel dazu wurde der US-amerikanische Standard von 30 Vollbildern pro Sekunde festgelegt, was wiederum 525 Zeilen pro Bild beziehungsweise 15750 (NTSC) zu bildende Zeilen in der Sekunde entspricht (vgl. Kapitel: „Fernsehnormen“).
Aufgrund der bestehenden Fernsehnormen (in Europa) funktioniert auch mit der Halbleitertechnik bei modernen digitalen Videosignalen die Fernsehbildübertragung auf der Basis einer Bildwiederholungsfrequenz von 50 Hz. Allerdings setzt sich allmählich - schon allein aufgrund der mittlerweile sehr großen Fernsehgeräte - eine verdoppelte Bildwiederholungsfrequenz (100 Hz) durch. Denn das bereits beschriebene Großbildflimmern erhöht sich vor allem bei Standbildern oder aber ruckartigen Bewegungen beziehungsweise Kameraschwenks, je größer der Bildschirm ist. Allerdings arbeiten auch hier manche Fernsehgeräte mit der einfachen Methode, die einzelnen Halbbilder doppelt zu projizieren. Die daraus resultierenden Qualitätseinbußen machen sich vor allem an „ausgefranzten“ horizontalen Laufschriften (z.B. Börsenticker) bemerkbar. Teurere Geräte verfügen über eine aufwendige Technologie, die es ermöglicht, die empfangenen Bilder neu zu berechnen, bevor sie dargestellt werden. Bewegtbilder erscheinen hier flüssiger. Doch grundsätzlich kann die Qualität der Bilder nur so gut sein, wie sie einst aufgenommen wurden.
Bildabtastung
Für das Auslesen und Anzeigen von Bildinformationen stehen heutzutage generell zwei Techniken zur Verfügung: das Zeilensprungverfahren und die progressive Abtastung im Vollbildmodus. Werden beide Verfahren kombiniert, kommt es nicht selten zu Fehlern in der Darstellung und damit zu sogenannten Artefakten. Denn moderne Fernseh- und Computerbildschirme, die mit der sogenannten progressiven Bildabtastung arbeiten, können herkömmlich im Halbbildverfahren erstellte Bilder nur bedingt „zusammensetzen“. Wurde beispielsweise ein Film im Jahre 1973 mit 25 Voll- beziehungsweise 50 Halbbildern im Zeilensprungverfahren gedreht, so kann er über vierzig Jahre später selbst mit einem hochwertigen 100-Hz-Fernseher kaum in bester HD-Qualität gezeigt werden. Deshalb ist nicht selten der Spruch zu hören oder zu lesen, dass ausschließlich die gute alte Röhre knackscharfe Halbbilder wiedergeben kann, weil nur sie seinerzeit dafür konzipiert wurde. Da ist etwas Wahres dran.
Zeilensprung-/Halbbildverfahren (Interlaced Scan)
Der englische Begriff „Interlace“ bezeichnet Bildsignale, die im Zeilensprungverfahren arbeiten. Die entsprechenden Formate sind PAL, NTSC und das HD-Format 1080i. Das Zeilensprungverfahren oder auch Zwischenzeilenverfahren wurde bereits Ende der 1920er Jahre von Fritz Schröter (Telefunken) entwickelt und 1930 als „Verfahren zur Abtastung von Fernsehbildern" patentiert (DRP-Patent Nr. 574085). Ziel der Entwicklung war die flimmerfreie Anzeige von Signalen mit einer möglichst geringen Bandbreite. Noch heute wird teilweise mit diesem Zeilensprungverfahren gearbeitet und vor allem in CCD-Sensoren verwendet.
Wird ein Zeilensprungbild erzeugt, werden dabei zwei Felder mit Zeilen generiert. Aus einem Videovollbild (Frame) entstehen somit zwei unterschiedliche Halbbilder (Fields), die nacheinander übertragen und aufgebaut werden. Das erste Halbbild (Upper Field) enthält alle ungeradzahligen Zeilen des Bildes. Für das zweite Halbbild (Bottom Field oder Lower Field) werden nur die geradzahligen Zeilen dargestellt.
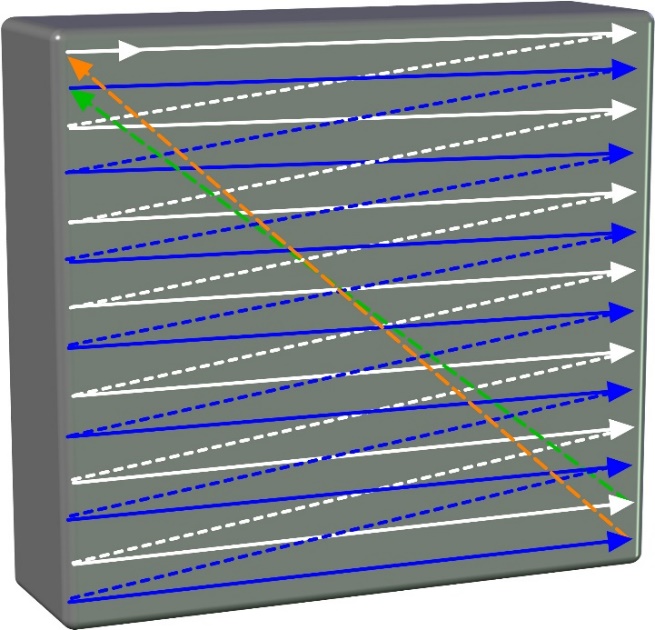
Vereinfachte Darstellung des Zeilensprungverfahrens
Neben der später entwickelten progressiven Bildabtastung (vgl. Kapitel „Vollbildverfahren“) erfolgt der Bildaufbau bei der klassischen Fernsehübertragung im Rahmen des Zeilensprungverfahrens, wie in obiger Abbildung dargestellt. Dabei wird oben links gestartet (weißer Pfeil).
Ein sogenannter Zeilen-Synchronimpuls im Fernsehsignal löst den Zeilenrücklauf aus, wobei der Elektronenstrahl in der Bildröhre für diese Zeit dunkel geschaltet wird. So wird Zeile für Zeile abgetastet, bis der untere Bildrand erreicht ist. Anschließend folgen einige Zeilen mit sogenannten Kennimpulsen (Vortrabanten, Bildsynchronimpuls, Nachtrabanten), bis der Bildrücklauf initiiert wird (grüner Pfeil). Während dieser sogenannten Austastlücke werden keine Bildinformationen übertragen, der Elektronenstrahl wird dunkelgetastet – ist also für das menschliche Auge nicht erkennbar. Das zweite Halbbild wird auf dieselbe Art und Weise übertragen (blaue Pfeile), am Ende landet der Rückstrahl (oranger Pfeil) wieder auf der ersten Bildzeile.
Allerdings werden diese Zeilen dennoch genutzt, beispielsweise für den klassischen Videotext oder aber IP-gestützte Informationen in Smart-TVs. Ist dieser Vorgang abgeschlossen, wird das nächste Bild aufgebaut. Der Bildaufbau erfolgt abwechselnd zeilenversetzt (weiße/blaue Pfeile). Im Idealfall werden die Zeilensprünge zu einem Gesamtbild von 625 Zeilen (Europa) integriert, wovon maximal 525 sichtbar (aktiv) sind. Die ungerade Zeilenzahl ist auf den Strahlrücksprung zurückzuführen, der bei beiden Halbbildern auf dem gleichen Vertikalspannungsniveau stattfindet. Wäre dies nicht gegeben, müssten die Spannungen pro Halbbild leicht verändert werden, was zu dem Problem führen kann, dass die Zeilen des zweiten Halbbildes nicht exakt zwischen denen des ersten abgebildet werden können.
Da also beim Senden eines Zeilensprungbildes immer nur die Hälfte der Zeilen übertragen wird, halbiert sich damit auch die Bandbreitennutzung. Sofern der Empfänger (z.B. Röhrenfernseher) ebenfalls mit der Zeilensprungtechnik arbeitet, werden auch hier zuerst die ungeraden und dann die geraden Zeilen eines Bildes angezeigt. Im Wechsel werden die so entstehenden Bilder mit einer Bildrate von 25 (PAL) oder 30 (NTSC) Vollbildern pro Sekunde aktualisiert. Das menschliche Auge kann diese Zeilensprünge nicht wahrnehmen, sondern erkennt nur vollständige Bilder. Im englischen Sprachraum wird diese Art der Bildübertragung „interlaced scan“ genannt, aber auch in Deutschland hat sich dieser Begriff mittlerweile durchgesetzt.
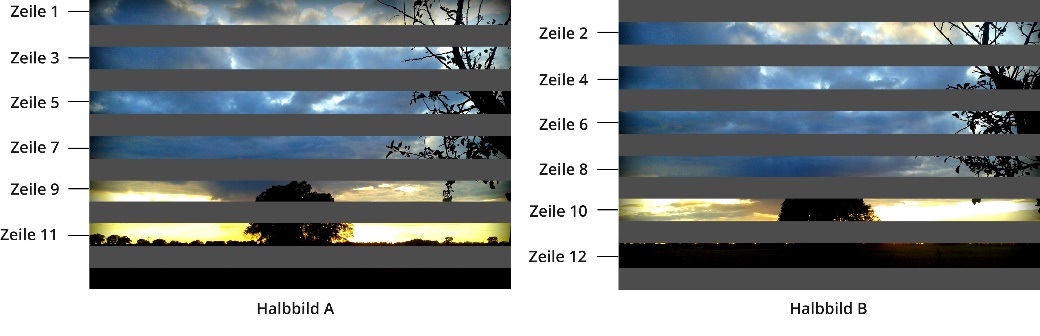
Vereinfachte Darstellung des Halbbild- bzw. Zeilensprungverfahrens (interlaced)
Deshalb werden Zeilensprungdarstellungen generell mit dem Buchstaben „i“ (wie interlacing) gekennzeichnet. Taucht also die Bezeichnung „480i“ auf, handelt es sich um eine Darstellung im Zeilensprungverfahren mit zwei Halbbildern. Gerade bei dem Wert „1080i“ im HDTV-Bereich kommt es nicht selten zu Missverständnissen, da im Allgemeinen oft angenommen wird, dass dieses Verfahren ausschließlich im analogen Fernsehen angewendet wurde. Doch tatsächlich steht in der digitalen Videodarstellung das „i“ ebenfalls für das Zeilensprungverfahren (Interlace) und die Zahl 1080 für die vertikale Auflösung.
Im Gegensatz zum ursprünglichen Analog-Fernsehen im PAL-Format löst HDTV (1080i) mit einem Wert von 2.073.600 Bildpunkten fünf Mal so hoch auf. Näheres hierzu findet sich in den Kapiteln „Grundlagen des Digitalfernsehens“ sowie „Video-Features der Zukunft“.
Zeilensprung-Artefakte
Wie bereits erwähnt, kommt es weniger innerhalb des Zeilensprungverfahrens, sondern vor allem bei der Kombination verschiedener Abtasttechniken zu sogenannten Artefakten. Werden Filme, die im Zeilensprungverfahren generiert wurden, auf Computerbildschirmen oder Fernsehgeräten mit progressiver Abtastung dargestellt, entstehen quasi zwangsläufig Fehldarstellungen; umgekehrt trifft dies ebenfalls zu: horizontale Kanten tanzen scheinbar auf und ab, einst homogene Flächen werden streifig dargestellt. Hat man also den Anspruch, mit einem digitalen ultrahochauflösenden Bildschirm mit Vollbildfahren einst analog und im Halbbildverfahren hergestellte Filme in bester Qualität zu sehen, wird man in der Regel enttäuscht.
Der Grund: Was einmal zerlegt war, kann niemals wieder vollständig zusammengefügt werden. Doch auch die immer höhere Bildkomprimierung in digitalen Displays ist für Mängel in der Wiedergabe verantwortlich. Hier werden Verzerrungen erzeugt, die man ebenfalls als Artefakte bezeichnet. Bei zeilensprungfähigen Monitoren oder Fernsehern sind diese kaum erkennbar, die neueren Geräte arbeiten allerdings zumeist mit progressiver Abtastung, bei der die Bildzeilen fortlaufend aufgebaut werden. Hier sind die Artefakte sichtbar und werden unter anderem als „Zacken“ wahrgenommen, die ursprünglich durch kurze Verzögerungen bei der Aktualisierung der geraden und ungeraden Zeilen entstanden sind. Denn ursprünglich stellte nur die eine Hälfte der Zeilen im Bild jeweils eine Bewegung dar, während die andere Hälfte aktualisiert wurde.
Besonders Standbilder von Videos, die seinerzeit im Zeilensprungverfahren erzeugt wurden, neigen bei Geräten mit progressiver Abtastung zu Fehldarstellungen. Werden diese Standbilder von einem Halbbild gemacht, reduziert sich die vertikale Auflösung. Dieser Bildverlust wird auch als Interlace-Faktor bezeichnet und mit etwa 30 Prozent beziffert. Bei einem Vollbild weisen vor allem bewegte Bildelemente kammerartige Doppelstrukturen auf und es kommt zu einer unschönen Zackenbildung. Hier stecken beide Halbbilder wie Kämme ineinander und wirken seitlich versetzt. So entsteht der sogenannte Moiré-Effekt (vgl. Abbildung), der durch eine falsche Überlagerung der Halbbilder verursacht wird. Es kommt zu einem Flackern des Bildes, das typisch ist für den Spezialfall des Alias-Effekts durch Unterabtastung.
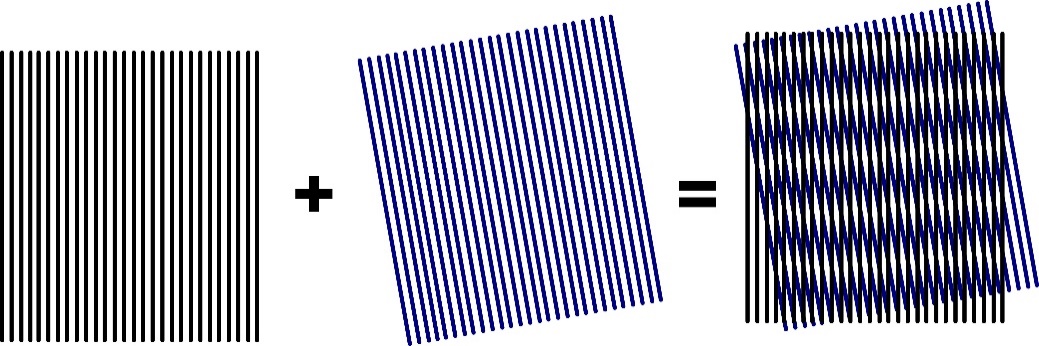
Moiré-Effekt
Auch bei schnellen Bewegungen oder rasanten Kameraschwenks ist es beim Zeilensprungverfahren kaum mehr möglich, aus den beiden Halbbildern ein deckungsgleiches Bild zu erstellen. Unsaubere Konturen und unruhige Bilder mit störenden Streifenmustern sind die Folge. Zur Lösung dieser Probleme wurde eine neue Form der Bildabtastung entwickelt, bei der die mängelbehaftete Halbbildwiedergabe entfällt.
Progressive Abtastung (Vollbildverfahren)
Die progressive Abtastung wurde ursprünglich in CCD- und CMOS-Sensoren und heute überwiegend in der Bildübertragung verwendet. Hier werden Vollbilder dargestellt, die sich kontinuierlich Zeile um Zeile von oben nach unten aufbauen. Die Darstellung der einzelnen Zeilen eines Progressive-Scan-Bildes erfolgt insofern fortlaufend (also progressiv): zuerst Zeile 1, gefolgt von Zeile 2, dann 3, 4, 5 und so weiter. Im Computerbereich war von jeher die progressive Abtastung üblich. Videokameras der Neuzeit, Flachbildschirme auf Plasma- oder LCD-Technologie sowie Displays und Monitore im Allgemeinen arbeiten heute generell „progressive“. Hierfür steht das „p“ in den Bildratenangaben von Videoformaten (z. B. 24p oder 25p). Bei der Bezeichnung „1080p“ handelt es sich um eine progressive HDTV-Darstellung mit 1080 Zeilen, bei „1080/24p“ um die gleiche Darstellung mit 24 Vollbildern (im Kino).
Wenn also - anders als beim Zeilensprungverfahren – echte Vollbilder und keine zeilenverschränkten Halbbilder gesendet und empfangen werden, verschwindet somit auch das Zeilenflimmern weitgehend. Mit dem Vollbildverfahren wird insofern eine höhere vertikale Auflösung erreicht, was wiederum dazu führt, dass Artefakte (z.B. ausgefranste Objektkanten) vermieden werden können.
De-Interlacing
Da viele aber auch heute noch Gefallen an den TV-Evergreens und Kino-Hits des 20. Jahrhunderts finden, wurde ein technisches Verfahren entwickelt, um quasi das einst historisch produzierte Filmmaterial für die Neuzeit bestmöglich aufzubereiten – also Halb- in Vollbilder zu konvertieren. Die aus dem Englischen übernommene Bezeichnung „De-Interlacing“ beschreibt im Grunde jenen Vorgang dieser Zeilenentflechtung. Wie wir wissen, ist dies heutzutage generell nötig, insbesondere dann, wenn Filme im Zeilensprungverfahren aufgenommen wurden, aber über Anzeigegeräte dargestellt werden sollen, die über einen anderen zeitlichen beziehungsweise vertikalen Bildaufbau verfügen. Mit der heutigen Technik stellt das De-Interlacing an sich kaum mehr ein Problem dar.
Moderne Fernsehgeräte sowie DVB-Empfänger, Blu-ray-Player oder Computer verfügen über einen integrierten De-Interlacer, der die Bildfrequenz zumeist automatisch anpasst. Jedoch basieren sowohl DVD- als auch antennenbasierte TV-Tunersignale (DVB-T) nach wie vor auf den Standards des Halbbildverfahrens. Insofern bleibt auch zukünftig ein exaktes De-Interlacing äußerst wichtig – jedenfalls bis zur generellen Umstellung auf DVB-T2 und restlichen Entsorgung der DVD-Player. Dabei bleibt das Grundproblem: Was einmal in Halbbilder aufgeteilt war, lässt sich nicht mehr exakt in Vollbilder wandeln. Exemplarisch sollen im Folgenden zwei Verfahren im Rahmen des De-Interlacings erläutert werden, wobei sich diese nicht generell auf die Konvertierung von Halb- in Vollbilder beziehen, sondern im ersten Beispiel auf die Bearbeitung von Halbbildern und ihren Bildwechselfrequenzen.
Pulldown
Wer es sich am Freitagabend auf seinem Sofa gemütlich macht und die preiswert erstandene DVD mit einem Blockbuster aus seiner Jugendzeit in den Blu-ray-Player schiebt, der denkt natürlich kaum darüber nach, ob sich die Bildformate und Bildraten überhaupt vertragen. Möchte man also einen Kinofilm (24 Vollbilder) für PAL (50 Halbbilder) optimieren, ist dies nicht ganz so einfach zu realisieren. Der Trick besteht darin, dass bei einer PAL-DVD anstatt der 24 Bilder im Original eben 25 überspielt werden (2:2-Pulldown). Insofern ist die logische Schlussfolgerung, dass ein Kinofilm auf einer DVD minimal schneller läuft, sich also die Laufzeit um zirka vier Prozent verkürzt.
Bei der Optimierung für NTSC mit einer Bildwechselfrequenz von 60 Hz ist das 2:2-Pulldown-Prinzip allerdings nicht möglich, da in diesem Fall von 24 Vollbildern in 60 Halbbilder konvertiert werden muss. Hier wird deshalb das erste Film-Einzelbild (A) dreimal wiederholt, das zweite Film-Einzelbild (B) nur zweimal. Diese Sequenzen werden nun sechs Mal im 3:2-Rhytmus wiederholt und in jeweils zwei Halbbilder zerlegt. Drei Bilder (A) und zwei Bilder (B) ergeben also insgesamt fünf Vollbilder. Sechsfach erstellt, ergeben sich insofern 30 Vollbilder, die in 60 Halbbilder zerlegt werden können. Diese Vorgehensweise wird entsprechend als 3:2-Pulldown bezeichnet. Aber auch für Videomaterial im Heimkinobereich ist das exakte De-Interlacing mittlerweile unabdingbar, zumal die hochauflösenden Wiedergabegeräte jede Bildverschlechterung konsequent anzeigen.

Referenzvideo der Firma BUROSCH zur Überprüfung eines De-Interlacers
Die Firma BUROSCH bietet hierzu Realfilmsequenzen an, die die Struktur von Hausdächern zeigen (vgl. Abbildung). Der Film funktioniert quasi wie ein Testbild: Flimmern die einzelnen Dachziegel, so arbeitet der De-Interlacer nicht akkurat. Ruckelt der Bewegungsablauf, so ist ebenfalls von einem unzureichenden De-Interlacing auszugehen.
Weave
Sollen im Umkehrverfahren Vollbilder als zwei aufeinander folgende Halbbilder mit demselben Zeitindex übertragen werden, muss vor der Darstellung das einfache Deinterlacing-Verfahren Weave angewendet werden. Hier wird das Bildmaterial im Vollbildverfahren aufgenommen und im Anschluss durch ein zusätzliches Videosignal in zwei Halbbilder zerlegt, um diese dann im Zeilensprungverfahren zu übertragen. Diese Technik wird als progressive segmented Frame (psF) bezeichnet und ermöglicht die Darstellung von Progressive-Scan-Bildern auf Geräten, die für das Zeilensprungverfahren ausgelegt sind.
Herkömmliche Übertragungsverfahren (z.B. PAL, NTSC) verwenden diese Methode, wozu im Übrigen auch das HDTV-Format 1080i gehört. Damit die übertragene Datenmenge ungefähr gleich bleibt, wird beispielsweise bei (Full HD) aufgrund der höheren Zeilen- oder Vertikal-Auflösung die zeitliche Auflösung halbiert. Filmmaterial, das auf diese Weise bearbeitet wurde, erhält die Kennzeichnung „psF“ (z.B. 1.080psF oder 576psF).
Gamma-Korrektur
Die Gammakorrektur ist eine hauptsächlich im Bereich der Bildverarbeitung oft verwendete Korrekturfunktion, welche ihre historischen Ursprünge jedoch in der Röhrenbildschirmtechnologie hat. Die Bildschirme früherer TV-Geräte konnten das Bildsignal nicht linear wiedergeben. Da es einfacher war, diese Nichtlinearität in den wenigen eingesetzten Kameras anstatt in allen Empfangsgeräten auszugleichen, wurden die Kameras dahingehend modifiziert mit nichtlinearen Signalen zu arbeiten.
Eine Gammakorrektur wird in abbildenden Systemen benötigt, um das nichtlineare Helligkeitsempfinden des menschlichen Auges zu kompensieren. Das Auge reagiert beim Anstieg auf eine doppelte Helligkeit nicht zwangsläufig mit einer Verdopplung der Helligkeitsempfindung. Die empfundene Helligkeit steigt in dunklen Bereichen steiler und in hellen weniger steil an. Das menschliche Auge hat ein Gamma von etwa 0,3 bis 0,5.
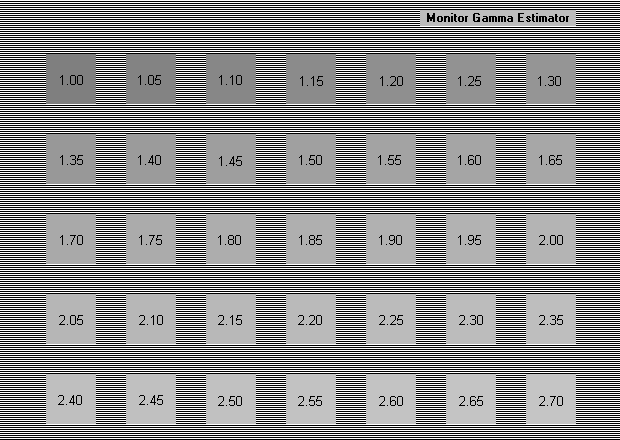
Grafik zur Bestimmung des Gammawerts im Selbsttest
Durch unterschiedliche Kontrastumfänge, Verläufe von Tonwertkurven, Gamma-Werte, Umweltbedingungen bei der Bildverarbeitung, individueller Wahrnehmung und Bildwiedergabe sowie der sequentiellen Anwendung mehrerer unterschiedlicher Verfahren mit verschiedenen Eigenschaften bei der Bilderzeugung, ist es notwendig, eine Gammakorrektur durchzuführen, um ein Bild als Ergebnis zu erhalten, welches entweder dem Originalbild entspricht oder aber mindestens den gewünschten Anforderungen.
Die Wahrnehmung des menschlichen Sehens ist nicht linear. Elektronische Displays sollen die menschlichen Sehgewohnheiten simulieren (nachbilden). Daher wird eine Korrektur notwendig, denn ein elektronischer Sensor, wie etwa ein CCD-Chip oder eine Elektronenstrahlröhre, arbeiten annähernd linear. Um dieses Problem so gut wie möglich zu beheben, wurde die Gammakorrektur eingeführt: A = EΥ (A: Ausgangssignal; E: Eingangssignal). Bei der Berechnung des Ausgangssignals A werden nur die Grauwerte verändert, Schwarz- und Weißpunkt bleiben erhalten, wenn das Eingangssignal E im Intervall [0,1] liegt, beziehungsweise auf 1 gesetzt wurde. Diese Korrekturfunktion trägt den Namen des Exponenten Gamma (Υ).
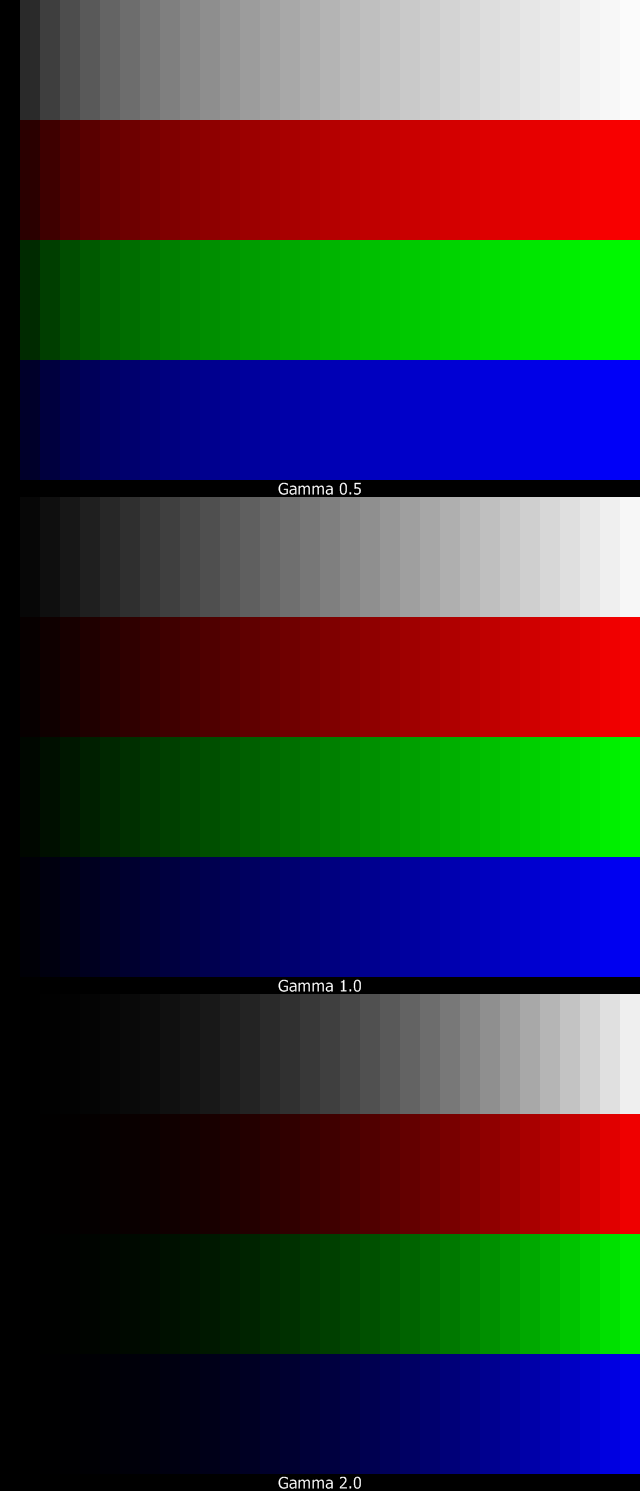
Beispiel für Gamma-Wert 2.0
Bei einem Gamma von 1 ist das Ausgangssignal gleich dem Eingangssignal. Bei einem Gamma größer als 1 wird die Ausgabe insgesamt etwas dunkler, hellere Stufen einer Grautreppe sind stärker abgestuft als die dunkleren. Bei einem Gamma kleiner als 1 wird die Ausgabe insgesamt heller, die dunkleren Stufen einer Grautreppe sind demnach stärker abgestuft als die hellen, ohne dass jedoch der hellste Wert Weiß (100 % Weiß) und der dunkelste Wert Schwarz (0 Prozent Weiß) dabei in der Helligkeit verändert wird.
Die Hersteller moderner Displays halten sich strikt an einen “idealen” Gammawert von ca. 2,2, um eine reale Helligkeitsempfindung des menschlichen Auges sicherzustellen. Der typische Gammakorrektur-Wert eines PC-Monitors oder eines digitalen TV-Gerätes liegt bei 2.2. Typischerweise kann dieser Wert auch über die Konfiguration des jeweiligen Bildschirms oder auch innerhalb des Betriebssystems verändert werden, eine Änderung ist jedoch nicht empfehlenswert. Auch fotographische Labore, welche Bildschirme testen, arbeiten mit einem Gammakorrektur-Wert von 2.2. Die entsprechende Belichtung eines für gut befundenen Bildes am Monitor ist daher nur bei einem Gammakorrektur-Wert von 2.2 garantiert.
Unter Mac OS galt für den Standard-Gammakorrektur-Wert von 2.2 bis vor kurzem noch eine Ausnahme. Mac OS verwendete in der Vergangenheit einen Gammakorrektur-Wert von 1.8. Dieser Wert war für einen Workflow ohne Farbmanagement gedacht. Der Gammakorrektur-Wert 1.8 führte dazu, dass die Darstellung auf dem Bildschirm besser der Tonwertreproduktion von Schwarzweißdruckern entsprach. Seit Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) liegt der Standard-Gammakorrektur-Wert auch unter Mac OS bei 2.2.
Nachfolgend wird anhand von vier markanten und geeigneten Beispielen die unterschiedlichen Gammafunktionen erklärt. Das Originalbild (folgende Abbildung) zeigt einen 32-stufigen Graustufenkeil mit zunehmender linear abgestufter Helligkeit von links nach rechts – linkes Feld 100 Prozent Weiß, rechtes Feld komplett Schwarz.
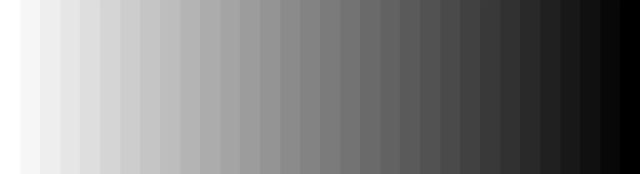
Gamma-Korrektur/Originalbild
Bei einem zu hohen Gamma sind die helleren Felder stärker abgestuft als die dunkleren, das heißt dunkle Bereiche im Bild lassen sich nicht mehr auseinanderhalten (vgl. folgende Abbildung).

Gamma-Korrektur/Gamma zu hoch
Bei einem zu niedrigem Gamma sind die dunkleren Felder stärker abgestuft als die helleren, das heißt helle Bereiche im Bild lassen sich nicht mehr auseinanderhalten (vgl. folgende Abbildung).

Gamma-Korrektur/Gamma zu niedrig
Bei einem S-förmig verzerrtem Gamma sind die mittelgrauen Felder stärker abgestuft als die äußeren, das heißt helle sowie dunkle Bereiche im Bild lassen sich nicht mehr auseinander halten (vgl. folgende Abbildung)
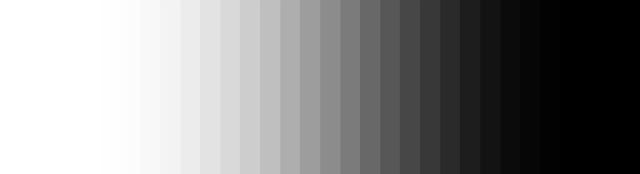
Gamma-Korrektur/ Gamma „S“-förmig verzerrt
Auch wenn die Gamma-Korrektur eigentlich aus dem Röhrenzeitalter stammt, ist diese insbesondere im Zusammenhang mit HDR immer noch aktuell. Moderne Displays müssen die Gamma-Korrektur einsetzen, um die Opto-Electronic-Transfer-Funktion (OETF) von Videokameras zu kompensieren. Die Gamma Korrektur bildet in diesem Fall die Nichtlinearität alter Röhrenbildschirme nach und wird eingesetzt, um über das gesamte System eine nahezu lineare Abbildung zu gewährleisten. Mehr zum Thema HDR findet sich in diesem Buch im Kapitel „Video-Features der Zukunft“.
Bewegungsunschärfe
Bewegungen darzustellen, war von jeher das größte Problem der Fernsehtechnik. Der Grund dafür ist nicht nur in den einzelnen Technologien zu suchen, sondern vor allem in der menschlichen Wahrnehmung. Läuft eine Maus über den Boden, sieht man unwillkürlich hin, blinkt irgendwo ein Licht, kann man es nicht ignorieren, und ein Fernseher in einer dunklen Kneipe zieht alle Augen auf sich. Unsere Netzhaut ist nur in der Mitte scharf, während die Ränder besonders empfindlich sind für jede Art der Bewegung oder Veränderung.
Das hat natürlich Folgen in Bezug auf die riesigen Bilddiagonalen moderner TV-Displays. Während sich früher das Bild eines Röhrenfernsehers mit einem Blick erfassen ließ und die Augen nicht hin- und herwandern mussten, kann man bei den großen Flachbildschirmen heute ein Objekt von links nach rechts verfolgen und wieder zurück – und stellt dabei plötzlich Veränderungen fest: Was im Stand knackscharf aussah, bekommt plötzlich weiche Konturen, die Bewegung erscheint ruckelnd und abgehackt. Bei rasanten Schwenks der Kamera bricht die Detailauflösung schlimmstenfalls komplett zusammen. So rückt die Bewegungsdarstellung ins Zentrum der Beurteilung von Bildschirmen. Schließlich handelt es sich bei Video- und TV-Signalen nicht um Standbilder. Anders als bei den Grundparametern Kontrast, Schärfe oder Farbumfang gibt es für die Darstellung von Bewegung aber kein genormtes Messverfahren, nicht einmal Testsignale für alle Problemfelder. Im Gegenzug gibt es jede Menge Probleme, die vielfältige Ursachen haben. Manche entstehen schon bei der Aufnahme, andere bei der Übertragung – und der Bildschirm selbst ist auch nicht ganz unschuldig.
Die Zeiten, in denen das Signal von der Kamera zum Fernseher direkt durchgeschleift wurde, sind nämlich vorbei. Eine Röhrenkamera tastete eine fotoempfindliche Schicht noch Zeile für Zeile ab und leitete die daraus entstehenden elektrischen Schwingungen weiter, bis sie schließlich auf dem Röhrenfernseher Zeile für Zeile wieder aufgebaut wurden. Heutzutage stecken zwischen CCD- beziehungsweise CMOS-Sensor und Flatscreen jede Menge Bildspeicher und Wandler, die das Signal an die Gegebenheiten von Studio, Übertragungsstrecke und Display anpassen.
Das klassische Bewegtbild ist der Kinofilm. Er wird schon seit bald einhundert Jahren mit 24 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Absolut gesehen, sind 24 Bilder pro Sekunde (Hertz, Hz) viel zu wenig. Denn für eine flüssige Bewegungsdarstellung braucht man mindestens 50 Hz – erst dann erscheint dem Auge eine Abfolge von Einzelbildern ruckelfrei. Damit das Bild nicht erkennbar flackert, sollte die Bildwiederholungsfrequenz noch höher sein. Deshalb projiziert man jedes Bild im Kino zwei- oder dreimal, sodass man auf 48 oder 72 Hz kommt. Aber selbst wenn es dann nicht mehr flimmert, der unsaubere Bewegungsablauf bleibt. Und zwar auch dann, wenn der Film digital aufgenommen wurde, denn auch hier hat sich Hollywood auf 24 Hz festgelegt. Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass schnelle Schwenks oder rasante Kamerabewegungen auf der großen Kinoleinwand eher zu Übelkeit im Publikum führen. Also nimmt man es in Kauf, dass quer durchs Bild fahrende Autos eben etwas ruckeln. In der DCI-Spezifikation für das digitale Kino ist zwar eine Verdoppelung auf 48 Hz bei der Aufnahme vorgesehen, realisiert wird diese Vorgabe jedoch nur bei 3D-Filmen. Denn 48 Hz lassen sich nicht zu 72 Hz verdoppeln, und die Wandlung in 60 Hz ist noch schwieriger als bei 24 Hz (vgl. Kapitel „Pulldown“). Neben den 24 Hz des Kinofilms existieren auch Filmaufnahmen mit 25 oder 30 Bildern pro Sekunde – beides sind Standards, die sich an der TV-Ausstrahlung orientieren.
Gern übersehen wird ein zweiter Punkt, der darüber entscheidet, wie stark Filmbilder ruckeln: die Verschlusszeit. Jeder Fotoamateur weiß, dass es verwischte oder verwackelte Aufnahmen gibt, wenn die Blende nicht schnell genug öffnet und schließt. Wenn der Kameramann also viel Licht braucht und deswegen den Verschluss lange offen lassen muss, sind bewegte Objekte im Bild ohnehin unscharf. In diesem Fall wirkt eine solche Aufnahme bei der Wiedergabe auch nicht ruckelig, sondern soft. Bei kurzer Shutter-Öffnung dagegen bleiben harte Kanten erhalten, dafür fällt das 24-Hz-Ruckeln umso mehr auf.
Ein Teufelskreis, der nicht so leicht zu durchbrechen ist. Bei 100-Hz-Geräten wird beispielsweise ein Zwischenbild errechnet, indem man das Bild vorher und nachher heranzieht. Wenn sich Objekte gegeneinander bewegen (wie beim EM-Halbfinale Fußball und Hintergrund), fehlen die Ergänzungsinformationen an den Konturen - der sogenannte Halo-Effekt tritt auf.
Für scharfe Konturen und ruckelfreie Bewegungen eignen sich nur Videokameras mit Vollbildabtastung (Progressive Scan) und mindestens 50 Hz. Aus diesem Grund haben sich zum Beispiel ARD und ZDF entschieden, bei HDTV auf das System 720p/50 zu setzen, das 50-mal pro Sekunde volle 1280 mal 720 Pixel liefert. Das von vielen anderen Sendern verwendete 1080i halbiert wie alle anderen Interlaced-Verfahren die Bewegungsschärfe. Das Ziel der TV-Übertragung heißt deshalb 1080p mit 50 oder 60 Bildern (je nach Fernsehnorm) pro Sekunde.
Local Dimming
Hersteller setzen immer mehr auf das sogenannte Local Dimming und machen mit dieser Funktion viel Werbung. Tatsächlich handelt es sich um ein Feature, das durchaus erwähnenswert ist. Grundsätzlich möglich ist das Local Dimming bei LCD/LED-Displays mit entsprechender Funktion und flächendeckender Hintergrundbeleuchtung (Direct-LEDs) oder aber seitlichem Backlight (Edge-LEDs). Wie wir es vom Lichtschalter mit Dimming-Funktion kennen, können die LEDs im Backlight partiell ausgeschaltet werden, was satte Schwarztöne und die Darstellung winziger Bilddetails in dunklen Szenen zur Folge hat. Das heißt, die Hintergrundbeleuchtung kann so besser dem Bild angepasst werden und wirkt weitaus homogener (gleichmäßiger) als bei herkömmlichen LCD-Panels. Besonders gut kann man die Qualität der Local-Dimming-Funktion in sehr dunklen Bildbereichen erkennen, in denen punktuell helle Sequenzen eingeblendet werden, beispielsweise bei einem Sternenhimmel oder einem beleuchten Hochhaus bei Nacht. Wenn die Hintergrundbeleuchtung qualitativ hochwertig ist, sind tatsächlich nur dort LEDs eingeschaltet, wo sich die Lichter in den Fenstern oder die Sterne befinden. Wenn nicht, kommt es zu unschönen Abbildungsfehlern. Lesen Sie dazu das folgende Kapitel.
Auch OLED-Displays profitieren von der innovativen Pixel-Dimming-Technologie, auf deren Basis nunmehr Bilder mit bisher undenkbaren Schwarzwerten, beeindruckender Tiefenwirkung und absolut lebensechten Farben dargestellt werden können. Anders als bei klassischen LED-Displays mit Hintergrundbeleuchtung kann hier jeder organische Pixel eigenständig und individuell Licht und damit Farbe erzeugen und sich ganz nach Bedarf selbständig an- oder ausschalten. Damit wird eine dynamische Genauigkeit bei der Bilddarstellung erreicht, die bei einem LCD-Bildschirm nicht möglich ist. Abgesehen davon sind OLED-Panels weitaus energieeffizienter und dünner, da auf eine Hintergrundbeleuchtung (LEDs) verzichtet werden kann. Darüber hinaus bieten OLED-Displays aus praktisch jedem Betrachtungswinkel ein verlustfreies und gestochen scharfes Seherlebnis – ohne Farbverzerrungen oder Detailverluste an den Bildschirmrändern.
Kurzum: Mit der Local-Dimming-Funktion können sich LEDs nicht nur selbständig ein- und ausschalten, sondern darüber hinaus auch noch je nach Bedarf heller oder dunkler regeln (dimmen), was sich überaus vorteilhaft auf die Schwarzwerte und damit auf den Kontrast auswirkt. Hinzu kommt die klare abgegrenzte Darstellung von einzelnen hellen Bildelementen (z.B. Sterne) ohne Lichthöfe. Gerade im Zeitalter von HDR ist also eine solche Funktion quasi notwendig. Und vor allem Fans des Horrorfilms aber auch Gamer werden sich freuen, wenn auf dem Display alle Feinheiten der dunklen Nacht und sogar die Regentropfen zu erkennen sind, die dem Killer von der schwarzen Kutte perlen. Näheres zur praktischen Anwendung findet sich im Kapitel „Bildwiedergabesystem – NEXT GENERATION“.
Abbildungsfehler
Was zu Beginn des Fernsehens quasi dazugehörte, schrumpfte mit dem technologischen Fortschritt auf einige wenige sogenannte Abbildungsfehler oder Artefekte. Im Zeitalter von 4K, OLED und HDR sind diese kaum noch vorhanden. Aber auch wenn diese Abbildungsfehler mit den aktuellen und zukünftigen Displaytechnologien perspektivisch ihre Relevanz verlieren, sollten sie Erwähnung finden und werden deshalb im folgenden Kapitel beispielhaft erläutert.
Klötzchenbildung
Der Antennenempfang hat generell den Nachteil, dass er witterungsabhängig ist. Dabei hat sich im Rahmen der Digitalisierung kaum etwas geändert. Das sogenannte Überreichweitensignal schwankt atmosphärisch bedingt, was sich in der Bild- und Tonqualität niederschlägt. Ein Aussetzen des Signals führt zur berühmten Klötzchenbildung, eingefrorenem Standbild und Audioverzerrungen. Bei Gewitter kann es passieren, dass der Empfang komplett gestört ist. Auch sind Signalverzögerungen von mehreren Sekunden typisch für den terrestrischen Empfang. Während sich der Nachbar mit terrestrischem Fernsehen bei einem Fußballspiel noch die Daumen drückt, freut sich der Nachbar mit Satellitenempfang bereits über das geschossene Tor. Grund für das verzögerte Signal ist die Videocodierung beziehungsweise Decodierung im Empfänger, die mehrere Bildsequenzen umfasst. Insofern stößt DVB-T an seine Grenzen, die nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass die Videodaten hauptsächlich als MPEG-2 codiert werden, obwohl es technisch durchaus möglich wäre, mit MPEG-4 codierte Video-Datenströme zu versenden. Hier wird der neue Standard DVB-T2 zukünftig zeigen, ob die versprochene Verminderung der Abbildungsfehler tatsächlich eintritt.

Klötzchenbildung bei schlechtem DVB-T-Empfang
Doch neue Standards versprechen nicht immer Fehlerfreiheit. In punkto Hintergrundbeleuchtung hat sich in den letzten Jahren einiges getan. LCD-Displays werden nicht mehr mit Leuchtstoffröhren bestrahlt. Das Schlagwort „Backlight“ ist keine Neuheit mehr. Allerdings kommt es bei den einhergehenden Abbildungsfehlern hier mitunter zu Verwirrungen. Einige Effekte, die vor allem auf eine mangelnde Homogenität der Hintergrundbeleuchtung zurückzuführen sind, sollen deshalb im Folgenden kurz erläutert werden.
Banding/Clouding
Der Fachbegriff "Banding" definiert das schlechte visuelle Ergebnis des nicht-synchronen Zusammenspiels zwischen verschiedenen signalverarbeitenden Stufen unter anderem bei der Bildwiedergabe eines Fernsehers. Im Idealfall sollte der Bildverlauf gleichmäßig und weich dargestellt werden. Je großflächiger das Display ist, desto deutlicher werden etwaig vorhandene Probleme bei der Signalverarbeitung visualisiert. Umso "flacher" das eigentliche Bild (z.B. Wolkenbilder, Gesichter/Hauttöne) und umso größer die physikalische Displayauflösung sowie Displayfläche ist, desto deutlicher kann der Banding-Effekt zutage treten.
Ursachen dafür finden sich auch und vor allem in aktuellen TV-Modellen durch das fehlerhafte Zusammenspiel zwischen einem normalen 8-Bit-Bildinhalt an sich, einer 8-Bit-Signalverarbeitung in der TV-Software und einem 10-Bit-Panel. So kann es zu deutlichen Treppenstufen in der Bilddarstellung kommen. Je nach Filmproduktion, dem eigentlichen Bild und der Display-größe sind diese Bandung-Streifen sichtbar, das heißt besonders bei Bildern von Wolken am Himmel, weshalb dieser Effekt auch „Clouding“ genannt wird.
Blooming
Vorwiegend bei dunklen Bildszenen kommt dieser Effekt (Blooming) zum Vorschein und bei Full-LED-Displays mit einer flächendeckenden Hintergrundbeleuchtung und Local-Dimming-Funktion. Der Vorteil dieser Technologie ist natürlich der großartige Kontrast, da im Backlight einzelne Bereiche (Cluster) je nach Anforderung dunkel- oder sogar ausgeschaltet werden können. Schwarz bedeutet dann tatsächlich schwarz. Bei fehlerhafter Verarbeitung der Panels und seinen unzähligen LEDs kann es jedoch passieren, dass im eigentlich dunkelgeschalteten Cluster ein oder mehrere LEDs fälschlicherweise nicht gedimmt werden. Eine punktuelle Dunkelschaltung ist somit nicht mehr gegeben, was eigentlich schwarz oder dunkelgrau sein sollte leuchtet zumindest teilweise in hellem Grau. Das technisch nicht ganz einwandfrei funktionierende Segment mit seinem nichtausgeschalteten LED strahlt also in das geforderte Schwarz. Daher hat dieser Effekt auch seinen Namen, denn im Englischen bedeutet „bloom“ nicht nur blühen, sondern auch strahlen. Wobei hier eigentlich die Schönheit gemeint ist, was eine gewisse Ironie nicht entbehrt.
Flashlights
Dieser Effekt ist mit dem Clouding verwandt und meistens bei sehr dunkler Umgebungsbeleuchtung zu erkennen. Er tritt in der Regel bei LED-Edge-Fernsehern auf, bei denen die Hintergrundbeleuchtung aus den Ecken oder Seiten kommt. „Flashlights“ bedeutet Taschenlampe. Bestimmte Bildbereiche erscheinen punktuell heller als gewollt, als würde jemand von hinten mit einer Taschenlampe leuchten, weshalb hier auch vom Taschenlampeneffekt die Rede ist. Gemeint sind helle Lichtkegel, die zumeist in den Ecken eines Displays auftreten und besonders dunkle Bildszenen verfälschen. Der Grund für solche Flashlights ist in der Regel in einer mangelhaften Hintergrundbeleuchtung zu suchen. Mitunter kann dieser Effekt aber auch auftreten, wenn das Gerät zu heiß geworden beziehungsweise Spannungen ausgesetzt ist.
Dirty-Screen-Effect (DSE)
Eine ungleichmäßige Ausleuchtung des TV-Display-Hintergrunds kann auch den sogenannten Dirty-Screen-Effekt zur Folge haben. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich hier um Schmutz auf dem Bildschirm, der natürlich eigentlich gar nicht vorhanden ist. Insbesondere bei Kameraschwenks entsteht dieser Eindruck, der jedoch auch durch eine schlechte MPEG-Codierung verursacht werden kann. In diesem Fall ist zumeist die Rauschunterdrückung im Fernseher zu hoch eingestellt. Feine Bilddetails werden in der Signalverarbeitung fälschlicherweise als Rauschen interpretiert (Rauschmuster).
Crosstalk/Ghosting
Dieser Effekt tritt ausschließlich bei der 3D-Wiedergabe auf. Neben dem herkömmlichen Anaglyphenverfahren oder der Polfiltertechnik sind Shutterbrillen für den anspruchsvollen 3D-Heimkinonutzer die bekannteste und beste Lösung (vgl. entsprechende Kapitel in diesem Buch). Leider bietet diese Technologie auch ein paar technische Probleme: Der sogenannte Crosstalk stört die Bildqualität bei der 3D-Wiedergabe. Gemeint sind sogenannte Geisterbilder (Ghosting), eine fehlgeleitete Bildinformation im rechten Auge, die eigentlich für das linke Auge bestimmt war. Diese zeigen sich insbesondere in auftretenden Doppelkonturen oder bei hohen Kontrastwerten in Form von schwarzen senkrechten Linien vor hellem Hintergrund. Diese Fehler in der 3D-Wiedergabe können nur mit entsprechenden Testbildern gemessen werden. Entsprechend den Segmentabschnitten einer Uhr kann auf den Crosstalk-Testbildern der Wert definiert werden, um wieviel Prozent die Bildinformation vom linken Auge Einfluss auf das rechte Auge hat. Dieser Wert ist abhängig vom Luminanz-Kontrast-Verhältnis und auch vom Chrominanz-Signal. Technische Mängel in der Synchronisation führen zu ungewollten Doppelbildern beziehungsweise einer Geisterkontur.
Soap-Effect
Im Rahmen der Behebung von unschönen Bewegungsunschärfen (vgl. entsprechendes Kapitel) werden nicht selten zusätzliche Zwischenbilder berechnet. Dies hat jedoch bei LCDs mitunter zur Folge, dass bewegte Objekte sich vom Hintergrund abheben, welcher hingegen statisch wirkt. Das Ergebnis ist dann eine Videosequenz, die wie eine billige Studioaufnahme aussieht, etwa wie die Kulisse in einer Daily-Soap, weshalb man hier vom Soap-Effekt spricht.
Halo-Effekt
Auch als Nachzieheffekt bekannt, tritt dieser Abbildungsfehler ebenfalls auf, wenn Zwischenbilder auf Basis des vorherigen und des folgenden Bildes berechnet und sich in schnellen Videosequenzen Objekte gegeneinander bewegen (wie beim EM-Halbfinale Fußball und Hintergrund). Hier fehlen dann wichtige Ergänzungsinformationen in der Bildverarbeitung, weshalb besonders an den Konturen der sogenannte Halo-Effekt auftritt. So zieht beispielsweise der schnell fliegende Fußball einen dunklen oder hellen Schweif hinter sich her.
Tipps zur Fehlerbehebung
Tritt ein Fehler unregelmäßig oder nur bei einer bestimmten Blu-ray-Disc oder einem einzigen Film auf, handelt es sich meistens nicht um ein Problem im Gerät. Sollten oben genannte Abbildungsfehler jedoch regelmäßig und unabhängig vom Videomaterial auftreten, ist in der Regel die Hintergrundbeleuchtung oder aber die Bildverarbeitung fehlerhaft. Letztere kann nicht optimiert werden. Hier sollte man sich mit dem Hersteller oder Händler in Verbindung setzen. Einige Fehler können jedoch auch im TV-Signal zu finden sein, etwa in der Qualität des Empfangs via Satellit, Kabel oder Antenne. Deshalb sollte bei auftretenden Artefakten erste einmal hier die Empfangsstärke überprüft werden. Ähnlich verhält es sich beim Streaming. Mitunter leidet die Bildqualität, wenn das monatliche Datenvolumen aufgebraucht oder an einem DSL-Strang zu viele Verbraucher zapfen (vgl. Kapitel „Das richtige Netz(werk)“ in diesem Buch).
Wenn Abbildungsfehler auftreten, die mit einer mangelhaften Hintergrundbeleuchtung begründet werden können, so kann das zum einen an einer schlechten Verarbeitung liegen oder aber das Display steht unter Spannung. Ursache dafür kann eine Überhitzung sein. Treten Banding- oder Flashlights-Effekte nur manchmal auf, dann sollte das Gerät ausgeschaltet und gut belüftet werden. Außerdem sollten Fernseher niemals direkt neben einer Heizquelle stehen und über sehr lange Zeiträume ununterbrochen laufen.
Um die Qualität der Hintergrundbeleuchtung zu überprüfen, sollte ein graues vollflächiges Standbild mit einem fünfzig prozentigen Grauanteil genutzt werden. Während das Bild auf dem TV-Display dargestellt wird, wird nun die Helligkeit und der Kontrast hoch- und runtergeregelt und die Bildwiedergabe beobachtet. So können verschiedene Abbildungsfehler (z.B. Banding) identifiziert werden, bestenfalls sind falsch geschaltete LEDs sichtbar. In diesem Fall sollte das Gerät zurückgegeben oder besser gar nicht erst gekauft werden.
Videoauflösungen
Umgangssprachlich wird die Auflösung grundsätzlich für das Maß einer Bildgröße verwendet, das die Anzahl der Bildpunkte (Pixel) nach Spalten (vertikale Auflösung) und Zeilen (horizontale Auflösung) einer Rastergrafik angibt. Im physikalischen Sinne ist mit der Auflösung die jeweilige Punktdichte bei der Wiedergabe beziehungsweise Bildabtastung gemeint. Somit ist die Bildauflösung ein Qualitätsstandard unter anderem für die Farbtiefe. Während man in der Digitalfotografie zumeist die Gesamtzahl der Bildpunkte (Mega-Pixel = 1 Million Bildpunkte) beziehungsweise pro Zeile und Spalte angibt, wird in der Fernsehtechnik die Anzahl der Bildpunkte pro Zeile mal die Anzahl der Zeilen gemessen.
Neben der räumlichen Auflösung wird in der Videoauflösung insofern auch die zeitliche Auflösung interessant, da es sich um Bewegtbilder handelt. Wie bereits erwähnt, wird die zeitliche Auflösung (Bildfrequenz) in Hertz (Hz) angegeben. Dabei ist vor allem das Verfahren der Bildabtastung von maßgeblicher Bedeutung, das heißt, ob also zwei Halbbilder im Zeilensprungverfahren (interlaced) oder aber jeweils ein Vollbild (progressive scan) eingelesen werden.
Zeitliche/räumliche Auflösung
In diesem Zusammenhang soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die bereits erörterten Fernsehnormen (PAL, NTSC oder SECAM) nicht generell per Definition zur Angabe für den Bildwechsel dienen. Videoauflösungen werden betreffend ihrer zeitlichen Auflösung mit den jeweiligen Bildabtastverfahren angegeben. Dazu werden im Allgemeinen die Abkürzungen „i“ für das Zeilensprungverfahren (interlaced) und „p“ für die progressive Bildabtastung (progressive) verwendet.
Aber auch andere Parameter sind für die Auflösung entscheidend. So beispielsweise das Seitenverhältnis, das generell als Bruch dargestellt (z.B. 16:9) wird, wobei sich der erste Wert auf die Breite und der zweite Wert auf die Höhe bezieht. Oftmals wird dieser Bruch auch auf 1 gekürzt beziehungsweise ausmultipliziert und entsprechend gerundet. Auf diese Weise wird aus der Angabe 4:3 beispielsweise der Wert 1,33:1.

Standard-Seitenverhältnisse im TV-Bereich
Die drei gebräuchlichsten Seitenverhältnisse für Fernsehgeräte sind in Abbildung 54 vergleichsweise dargestellt: Das im analogen Fernsehen als Standard verwendete Format 4:3 (1,33:1/grün), in den 1990er Jahren eingeführte Format 16:9 (1,87:1/rot) sowie das seit 2009 für besonders breite Geräte genutzte Format 21:9 (2,37:1/blau), das insbesondere Kinofilme (2,39:1) ohne horizontale Streifen wiedergeben kann.Fasst man alle Parameter der Bild-/Videoauflösung zusammen, so entstehen ganz unterschiedliche Werte für die einzelnen Videoformate, die in der folgenden Tabelle zusammengefasst sind (vgl. Abbildung). Nicht selten wird davon ausgegangen, dass die Bildauflösung beziehungsweise die Bildgröße mit der Größe der jeweiligen Videodatei zusammenhängt. Jedoch können auch sehr kleine Bilddateien über eine hohe Auflösung verfügen.
|
Videoformat |
Breite |
Höhe |
Seiten- verhältnis |
Pixel |
|
analog |
||||
|
320 |
240 |
4:3 |
76.800 (0,08 MP) |
|
|
533 |
400 |
4:3 |
213.200 (0,21 MP) |
|
|
digital |
||||
|
VCD (PAL) |
352 |
288 |
4:3 |
92.160 (0,09 MP) |
|
SVCD (PAL) |
576 |
480 |
4:3 |
276.480 (0,28 MP) |
|
DVB (PAL) |
720 |
576 |
4:3/16:9 |
414.720 (0,41 MP) |
|
HDTV (720p) |
1280 |
720 |
16:9 |
921.600 (0,92 MP) |
|
Full-HD (1080p) |
1920 |
1080 |
16:9 |
2.073.600 (2,07 MP) |
|
2048 |
1536 |
4:3 |
3.145.728 (3,15 MP) |
|
|
UHD-1 (4K) |
3840 |
2160 |
16:9 |
8.294.400 (8,30 MP) |
|
4096 |
3072 |
4:3 |
12.582.912 (12,58 MP) |
|
|
UHD-2 (8K) |
7680 |
4320 |
16:9 |
33.177.600 (33,2 MP) |
Übersicht gängiger Videoformate (Auflösung)
Insofern ist der Zusammenhang zwischen der Größe des Datenvolumens nicht zwangsläufig kongruent zur Höhe der Bildauflösung. Letztlich liegt es an der Qualität der Wiedergabe, wie hochwertig das Foto- oder Videomaterial verwendet werden kann. Deshalb können Aussagen über die Auflösung generell nur im Zusammenhang mit der Wiedergabe getroffen werden. Wenn beispielsweise Filme in Ultra HD produziert aber auf einem alten Röhrenfernseher wiedergegeben werden, dann ist relativ klar, dass die Bildqualität erhebliche Einbußen erfährt. Insofern ist die Bildauflösung allein noch kein direktes Maß für die Qualität.
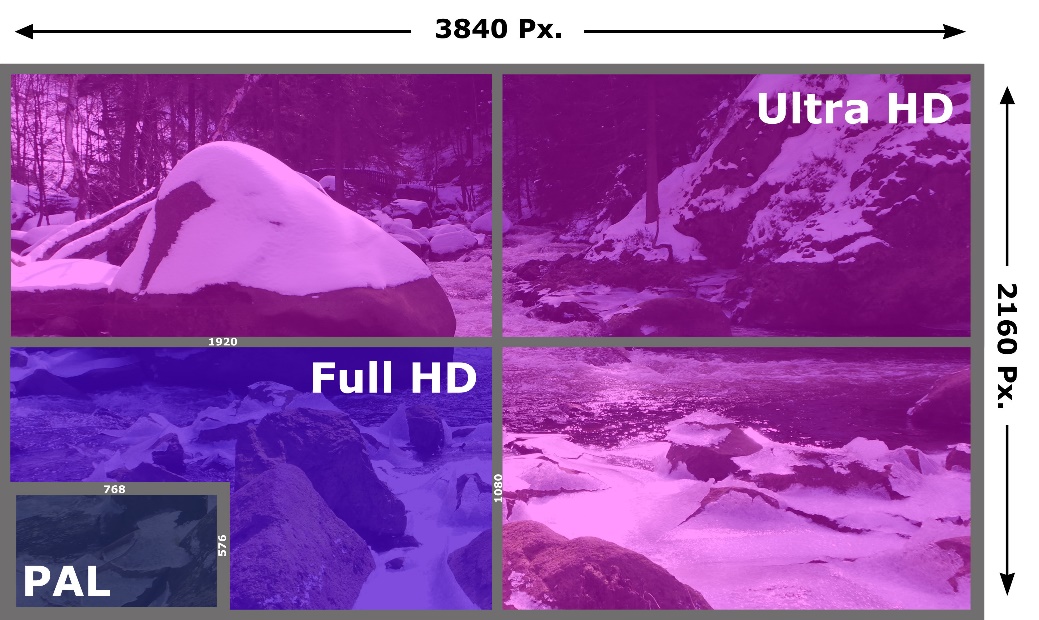
Beispiel für Bildauflösungen
Skalierung
In diesem Zusammenhang kann man auf die Aussage zurückkommen, dass nur die gute alte Röhre knackscharfe Bilder liefern kann. Denn nur bei analogen Röhren-Bildschirmen war das Format des Eingangssignals identisch mit der Wiedergabe. Hier konnten mithilfe der Steuerelektronik verschiedene Videoformate mit der gleichen vertikalen und horizontalen Bildauflösung wiedergegeben werden. Hingegen ist in modernen digitalen Bildschirmen das Wiedergaberaster vorbeschrieben und variiert je nach Bauart. Deshalb kann das Eingangssignal von der tatsächlichen Wiedergabe abweichen. Entsprechend müssen die eingegangenen Bildpunkte je nach Wiedergaberaster skaliert werden, wobei es hier nicht selten zu Verlusten kommt, die sowohl bei einer Verkleinerung als auch bei einer Vergrößerung entstehen können. Insbesondere bei der analogen Fernsehübertragung werden die Bildpunkte selbst oft nicht quadratisch, sondern rechteckig dargestellt. Aber auch durch die diversen Videoformate kommt es zu unschönen Begleiterscheinungen (vgl. Abbildung).

Bildverzerrungen bei unterschiedlichen Videoformaten
Um die Filmfläche optimal nutzen zu können, wurde bereits in den 1950er Jahren das sogenannte anamorphotische Verfahren (anamorph: griech. umgestaltet) in der Filmtechnik eingesetzt, um breitbandige Kinoformate auf analogen normalformatigen Fernsehgeräten abspielen zu können. Da es sich hierbei um geometrisch-optische Verzerrungen wie etwa bei einem Hohlspiegel handelt, ist die synonyme Verwendung des Begriffes im Zusammenhang mit der digitalen Bildübertragung falsch. Allerdings muss auch hier das Bild beispielsweise bei HDTV bis zu 25 Prozent gestaucht werden. Dies begründet sich aus den immer breiter werdenden Geräten. Der Unterschied zwischen dem herkömmlichen PAL-Format (SDTV) und HDTV ist in der folgenden Abbildung erkennbar.
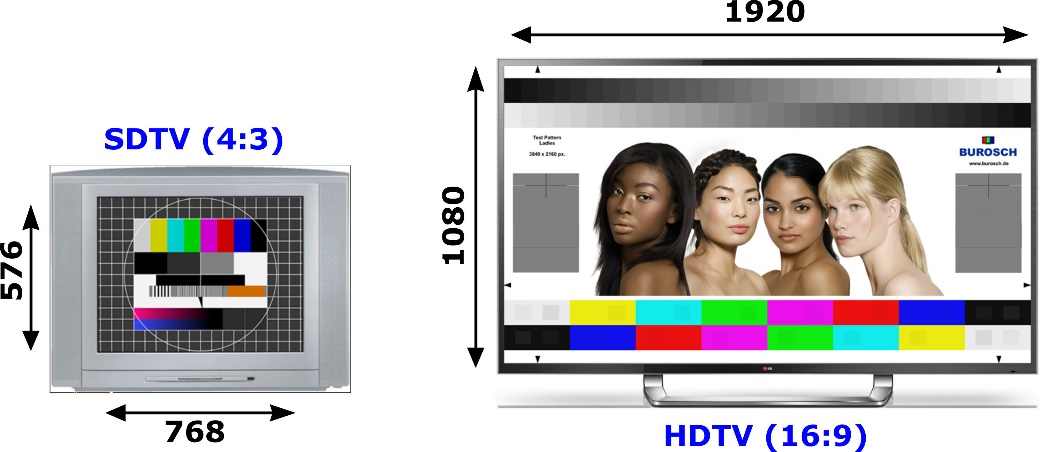
Unterschied zwischen SDTV und HDTV
Grundsätzlich kann man hochauflösende Videos nur dann hundertprozentig genießen, wenn das Gerät der Wiedergabe die technischen Voraussetzungen erfüllt. Aber auch der beste Fernseher ist nur so gut, wie seine Einstellung. Da Farbe lediglich eine subjektive Wahrnehmung ist, sollte man sich hier nicht ausschließlich auf die Werkseinstellungen oder das bloße Auge verlassen. Um die heute üblichen hohen Qualitätsstandards auch tatsächlich in vollem Umfang ausnutzen zu können, sollten als „Feinschliff“ sogenannte Testbilder bei der präzisen Einstellung verwendet werden. Mehr zu diesem Thema steht unter anderem im folgenden Kapitel „Bildeinstellungen/Kalibrierung“ aber auch am Ende dieses Buches.

Abbildung 66:Burosch TV Refeerenz Testbild
Native Auflösung
Insofern ist gerade für die Feinheit der Farbabstufungen einzelner Bildelemente (Farbtiefe) die sogenannte native Auflösung qualitätsbestimmend. Damit ist die exakte digitale Auflösung des Gerätes gemeint, das zur Bildwiedergabe verwendet wird. Der schlichte Vergleich zwischen der PAL- und HDTV-Auflösung macht den Unterschied deutlich: Der PAL-Standard umfasst 576 sichtbare Zeilen (vertikale Auflösung) und 768 Linien (horizontale Auflösung) und entspricht damit 11.059.200 Bildpunkten pro Sekunde. HDTV-Standards hingegen bieten 51.840.000 (1080i) beziehungsweise 46.080.000 (720p) Bildpunkte pro Sekunde. Die Gesamtbildpunktzahl erhöht sich bei HDTV auf etwa das Fünffache, was sich sowohl in schärferen Konturen, brillanteren Farben und generell in einer höheren Tiefenschärfe des Fernsehbildes bemerkbar macht.
Im Jahre 2016 ist HDTV jedoch schon fast wieder Makulatur. Hier sprechen wir im Zusammenhang mit Ultra HD/4K über ein weiteres Vielfaches in Bezug auf die Pixelanzahl – nämlich von 8 Millionen Bildpunkten. Und auch dieser Wert stellt nur eine Momentaufnahme dar, insbesondere weil die bereits erwähnte ITU-Empfehlung Rec.2020 perspektivisch die Bildauflösung 8K (UHD TV2) vorsieht, welche in derzeitigen TV-Prototypen bereits realisiert wird.
|
PAL |
720p |
1080i |
|
|
Auflösung |
576 x 768 |
720 x 1280 |
1080 x 1920 |
|
Bildpunkte gesamt |
442.368 |
921.600 |
2.073.600 |
|
Bildpunkte/Sekunde |
11.059.200 |
46.080.000 |
51.840.000 |
|
Format |
4 : 3 |
16 : 9 |
16 : 9 |
|
Frequenz |
50 Hz |
50 Hz |
50 Hz |
|
Bilddarstellung |
Halbbild (interlaced) |
Vollbild (progressive scan) |
Halbbild (interlaced) |
Vergleich PAL/720p/1080i
Pixeldichte
Ebenfalls bereits erwähnt wurde, dass der Begriff „Auflösung“ umgangssprachlich oft synonym verwendet wird. In der Drucktechnik (z.B. Zeitung) spricht man, wenn Bildpunkte gemeint sind, von dots per inch (dpi), bei Bild- und Videomaterial hingegen von pixel per inch (ppi) oder vielmehr Pixel pro Zoll. Im Zusammenhang mit der Pixelgröße wird nicht selten von einer „relativen Auflösung“ gesprochen, was allerdings falsch ist. Denn der Abstand der einzelnen Bildpunkte kann exakt gemessen werden und stellt somit eine physikalische Größe dar. Die Pixel- oder auch Punktdichte ist gerade in der heutigen digitalen Bild- und Videoproduktion das Maß für die Detailgenauigkeit und steht in direktem Zusammenhang mit der Qualität der Wiedergabe.
Doch die höchste Pixeldichte nützt wenig, wenn die Fläche, auf der das Bild dargestellt wird, zu klein ist. Das menschliche Auge könnte die Brillanz von 1920x1080 (HD), 3840 × 2160 (UHD-1/4K) oder gar 7680 × 4320 Pixel (UHD-2/8K) Bildpunkten kaum erfassen, wenn diese auf einer Briefmarke abgebildet würden. Umgekehrt sehen wird grobe Pixelstrukturen auf großen Bildschirmen, wenn die Punktdichte (Auflösung) zu gering ist. Insofern ist bei gleicher Auflösung die Bildschirmdiagonale maßgeblich. Deshalb sollte man sich von den mitunter extremen Unterschieden in der Angabe der ppi bei diversen Produktgruppen nicht irritieren lassen.
|
Gerät/Produktgruppe |
Display- Auflösung (Pixel) |
Display- Diagonale (Zoll) |
Pixeldichte (ppi) |
|
Samsung Gear 2 (Smartwatch) |
320x320 |
1,63 |
278 |
|
LG G3 (Smartphone) |
25601440 |
5,5 |
538 |
|
Kindle Voyage (eBook-Reader) |
1440x1080 |
6 |
300 |
|
Samsung Galaxy 8.4 (Tablet-PC) |
2560x1600 |
8,4 |
359 |
|
Walimex Pro Director (PC-Monitor) |
1920x1080 |
10 |
220 |
|
Toshiba Satellite (Notbook) |
3840x2160 |
15,6 |
282 |
|
Reflexion LED 1971 (Bildschirm) |
1920x1080 |
18,5 |
119 |
|
Apple iMac 27''/Retina-5K-Display (All-in-One-PC) |
5120x2880 |
27 |
218 |
|
Sony VPL-VW1100ES (Beamer) |
4096x2160 |
60 bis 300 |
77 bis 15 |
Produkte im Vergleich nach Pixel, Zoll, ppi
Die Fachzeitschrift Computerbild hat auf ihrer Internetseite (2015) einen Vergleich verschiedener Produktgruppen in Bezug auf ihre Auflösung und Displaydiagonalen durchgeführt. Ein Auszug der erstplatzierten Produkte ist in Abbildung 61 dargestellt und zeigt, dass die Daten weit auseinander gehen können, grundsätzlich aber Parallelen zwischen Displaygröße und Pixeldichte erkennbar sind.
Die zurzeit höchste Auflösung bringt das digitale Videoformat Ultra HD mit den Bildauflösungen 4K und 8K. Demnach hat das 4K-Format für TV mit 3840 × 2160 Bildpunkten eine viermal so hohe Pixelanzahl gegenüber der TV-Auflösung Full HD. Das 8K-Format (7680 × 4320 Pixel) löst vertikal und horizontal jeweils viermal so fein auf wie Full HD, insofern bietet dieses Format (in Japan: Super Hi-Vision) sechzehnmal so hohe Auflösung. Abbildung 62 zeigt den qualitativen Unterschied zwischen HD und UHD/4K.
Mit einer höheren Pixelzahl wird es natürlich leichter, auch die Displays zu vergrößern und dabei immer noch eine hervorragende Bildqualität zu garantieren. Die Krümmung, die heute nicht selten zu einem ultrahochauflösenden Display dazugehört, soll eine bessere Tiefenwirkung erzeugen.

Unterschied HD und 4K
Allerdings sollte beim Kauf eines solchen Heimkinos immer auch an die Größe des Umfeldes gedacht werden. Denn ein Fernseher mit beispielsweise 65 Zoll Bildschirmdiagonale muss auch ins Wohnzimmer passen. Dabei ist insbesondere der Betrachtungsabstand wesentlich für einen exzellenten Filmgenuss. Allerdings bietet gerade eine hohe Auflösung auch die Möglichkeit, dichter am Gerät sitzen zu können. Was ist also optimal und warum?
Betrachtungsabstand – Was ist dran?
Gibt man in eine Online-Suchmaschine den Begriff „Sitzabstand TV“ ein, findet man unzählige Artikel zum Thema. Und genauso zahlreich sind die entsprechend beschriebenen Tipps und Tricks. Das Dumme daran ist nur, dass fast jeder Ratgeber etwas anderes empfiehlt und jeder von sich behauptet, den richtigen Abstand beziehungsweise die richtige Formel für den perfekten Betrachtungsabstand gefunden zu haben. Einige Regeln sind richtig, andere jedoch weniger. Deshalb soll an dieser Stelle ein wenig Licht ins Dunkel gebracht und detailliert beschrieben werden, was es mit dem empfohlenen Betrachtungs- oder Sitzabstand auf sich hat.
Den TV passend zur Größe des Wohnzimmers aussuchen
Ein prinzipieller Rat, der eigentlich schon immer galt, und das unabhängig von der Bildschirmtechnologie: Man wählt die Größe des TV-Gerätes passend zu den vorhandenen Raumverhältnissen. Jedenfalls in der Regel, denn umgekehrt wird es meistens schwer. Es macht also wenig Sinn, sich in ein briefmarkengroßes Wohnzimmer einen XXL-Flat zu stellen oder zu hängen, vor allem wenn zwischen Sitzmöbel und Fernseher gerade mal eine Kaffeetasse passt. Imposant ist in diesem Zusammenhang das eine. Schlechter Geschmack das andere – vom Optimum der Bildwiedergabe mal ganz zu schweigen.
Im Zeitalter von Ultra HD und HDR werden allerdings die Riesendisplays immer populärer und viele Verkäufer nutzen die sehr hohe Auflösung als Argument, dass die Einhaltung eines gewissen Sitzabstandes quasi überflüssig sei. Grundsätzlich ist hier etwas Wahres dran. Der Rest ist Marketing. Vor dem Kauf eines neuen Gerätes sollte man sich schlichtweg einen Zollstock nehmen und im Beisein aller Familienmitglieder einig darüber werden, wie groß das gute Stück denn tatsächlich werden soll. Denn mal abgesehen von allen technischen Möglichkeiten ist und bleibt so ein Fernseher reine Geschmackssache. Und die kann mitunter meilenweit auseinander liegen. Der Teenager mit seiner Spielkonsole spricht sich im Allgemeinen für die maximale Bilddiagonale aus, die Ehefrau und Mutter hingegen für ein schickes Modell, das zur Einrichtung passt, während es Papa eigentlich egal ist, Hauptsache er kann in Ruhe Fußball schauen. Ein Mittelwert ist hier meistens die beste Entscheidung.
Von der Auflösung hängt es ab
Wer die Hürde des familiären Konsens‘ genommen hat, für den sind die technischen Details ein Klacks. Natürlich hängt der Sitzabstand maßgeblich von der Auflösung des TV-Displays ab. Die internationale „Society of Motion Picture and Television Engineers“ empfiehlt, die Bilddiagonale mal 1,63 als Sitzabstand zu berechnen, nach dem THX-Standard bietet die Bilddiagonale mal 1,19 ein annäherndes Kinogefühl, und viele Fachleute empfehlen als Richtwert gern die Bilddiagonale mal 2,5 zu nehmen. Allerdings beziehen sich diese Werte lediglich auf Full HD. Da Ultra HD aber die vierfache Full-HD-Auflösung hat, wird oft empfohlen, die Werte hier einfach zu halbieren. Ein anderer Rat für den korrekten Sitzabstand zum UHD-TV ist, die Bildhöhe einfach mal Zwei zu nehmen. Zu diesen geläufigen Tipps kommen zahlreiche weitere, deren Aufzählung allerdings nur zu einem unnötigen Durcheinander führen würde.
Wer Pixel sieht, sitzt zu nah
Wer sich nun für eine bestimmte oder zumindest ungefähre Bildschirmgröße entschieden hat, über die Hintergründe der Auflösung Bescheid weiß, sich aber dennoch unsicher ist, der sollte seinen Favoriten im gut sortierten Fachhandel aus der Nähe betrachten. Wenn möglich, wählt man vor Ort den individuellen Abstand, der in etwa mit den räumlichen Gegebenheiten zu Hause übereinstimmt. Denn auch wenn die menschliche Wahrnehmung im Grunde bei uns allen genauso funktioniert, sieht doch jeder Mensch aufgrund der individuellen Beschaffenheit und Funktionalität seiner Augen auf ganz unterschiedliche Weise. Wenn man nun im TV-Fachmarkt vor seinem neuen Lieblings-TV steht, ist letztlich nur eines entscheidend: Wer Pixel sieht, ist zu nah dran. Jetzt kann man entweder überlegen, die Couch bis in den letzten Winkel seines Wohnzimmers zu schieben, eine Wand wegzureißen oder aber sich für eine Nummer kleiner entscheiden. Denn je größer der TV, je größer sind physikalisch gesehen auch die einzelnen Bildpunkte/Pixel. Bei jeglichen Displayarten, egal ob nun Smartphone, Tablet, PC-Monitor oder Fernseher, wird der Gesamtbildeindruck maßgeblich durch die PPI/Punktdichte bestimmt. Je höher der PPI-Wert (PPI = Pixels per Inch/Pixel pro Zoll) eines Displays, desto schärfer und feiner wirkt das Bild. So bietet beispielsweise ein 12 Zoll großes Display mit Full HD Auflösung die gleiche Bildschärfe wie ein 24 Zoll großes Display in UHD-Auflösung.
Wie lautet die Faustregel?
Zur Vielfalt der Geräte und Auflösungen gibt es naturgemäß auch nicht nur eine Faustformel. Im Full-HD-Bereich ist folgende Empfehlung sinnvoll:
Betrachtungsabstand = Bildschirmdiagonale mal 1,5.
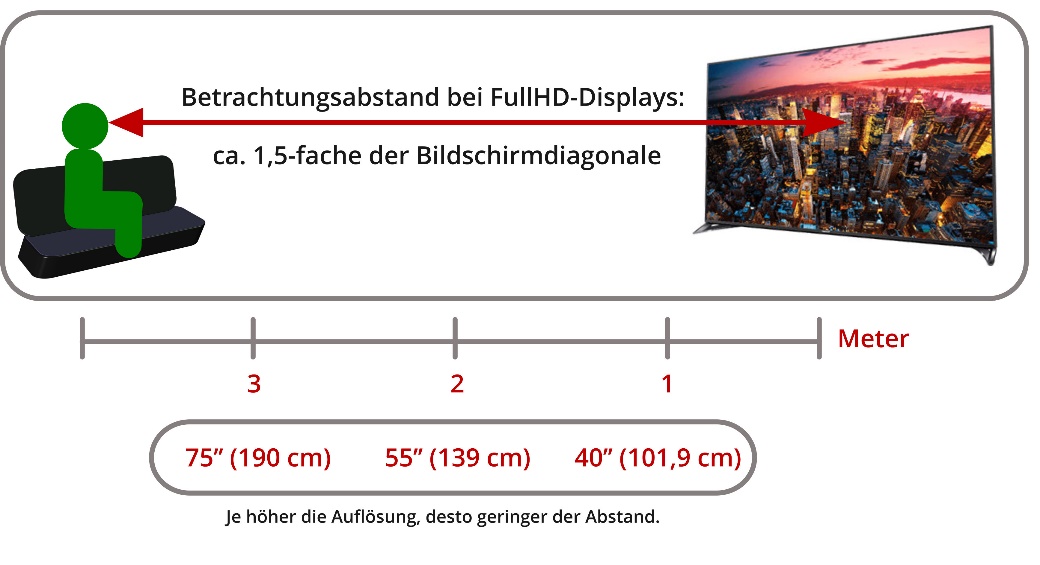
Betrachtungsabstand mit Faustformel
Bei einem Full-HD-Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll wären das in etwa zweieinhalb Meter (65 Zoll/165 cm x 1,5 = 247,5). In der Analogtechnik (SD) lag der Faktor der oben genannten Faustformel bei 2 bis 3. Diese Werte können gefahrlos aus dem kollektiven Gedächtnis gestrichen werden, es sei denn, man verfügt über einen Flachbildschirm aus dem letzten Jahrtausend. Auch ist der theoretisch beste Sitzabstand von rund einem Meter zu einem UHD-Display mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll (139 Zentimeter) auch ziemlich theoretisch.
Mittelwert und persönlicher Eindruck
Aller grauen Theorie zum Trotz lautet deshalb der BUROSCH-Praxistipp: Wählen Sie den Sitzabstand einfach so, wie er Ihnen am besten zusagt und wie es Ihre Räumlichkeiten zulassen. Messen Sie im Vorfeld genau aus, testen Sie vor dem Kauf, lassen Sie sich nichts aufschwatzen und entscheiden Sie gemeinsam.
Farbräume und photometrische Größen
Im Prinzip gibt es unendlich viele Farbräume, die durch die Koordinaten der Primärfarben (Rot, Grün, Blau), den Weißpunkt (Maximalhelligkeit) und den Helligkeitsverlauf (Gradation/Gamma) bestimmt werden. Die meisten unter uns haben sicherlich schon einmal die Begriffe Adobe-RGB, sRGB, Rec.709 oder aber Rec.2020 gehört. Letzterer kommt derzeit in vielfältiger Weise im Marketing für die aktuellen TV-Modelle zum Einsatz oder wird bereits (wenn auch etwas voreilig) in den entsprechenden Menü-Funktionen angeboten. All diese Bezeichnungen beschreiben typische Farbräume aus den Bereichen Foto, Film und Fernsehen.
Die sechs Symbole in der folgenden Abbildung beschreiben die Wellenlängenbereiche von Radioaktivität, Röntgenstrahlen, Ultraviolett, sichtbares Lichtspektrum des Menschen, Infrarot und Radiowellen (von links nach rechts). Die Begriffe Lichtspektrum und Farbspektrum beschreiben im Grunde dasselbe. Das Lichtspektrum reicht von Ultraviolett bis Infrarot. Die Wellenlängen dieser Spektralfarben werden in Nanometer (nm) gemessen. Vom kompletten Lichtspektrum kann das menschliche Auge nur einen kleinen Bereich wahrnehmen, dieser Frequenzbereich beträgt etwa 380 nm (Violett) bis 780 nm (Rot). Näheres hierzu findet sich im Kapitel „Farbwahrnehmung“ in dieser Dokumentation.
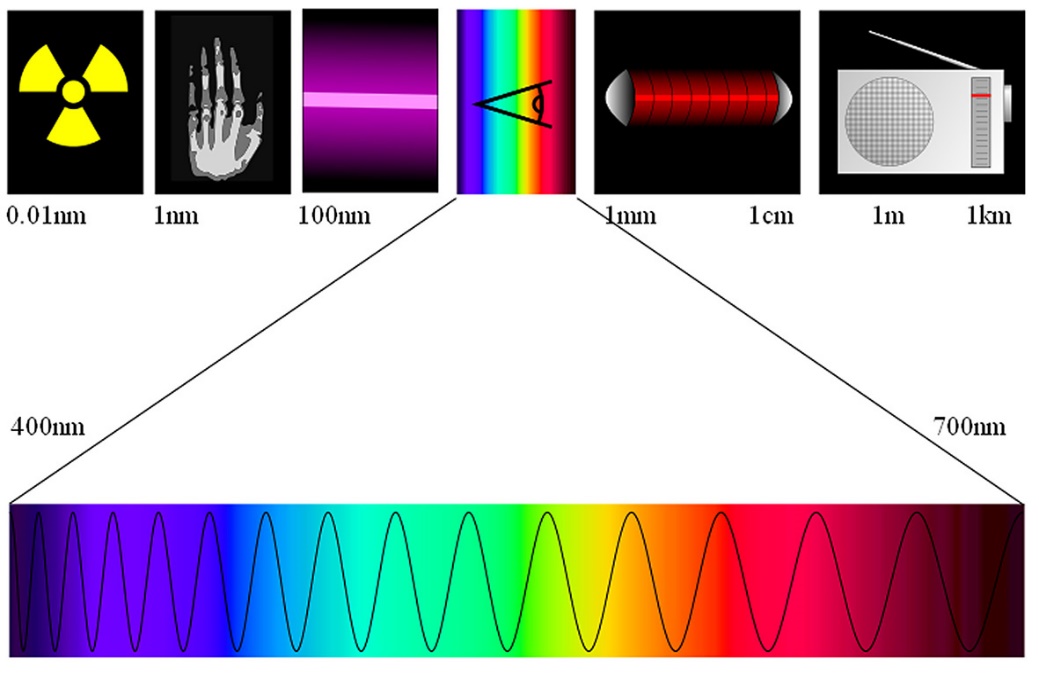
Wellenlängenbereich der menschlichen (visuellen) Wahrnehmung
Die Film- und Fernsehindustrie hat schon relativ früh erkannt, dass es sinnvoll ist, nur Farben in einem Film darzustellen, die der Mensch auch sehen kann. Auf diese Weise kann bei TV-Übertragungen sowohl Potenzial in Bezug auf die Bandbreite als auch Speicherplatz beim Trägermaterial (z.B. Blu-ray) eingespart werden. Wie bereits erwähnt, ist die Darstellung von Farben keine Geschmacksache. Aus diesem Grund wurden verbindliche Standards für die Industrie eingeführt. Das Ziel ist es, dass die verschiedenen Produktionsprozesse dieselben Farbmischungen verwenden, die als Standard definiert sind. An diese Standards halten sich alle am Film beteiligten Personen und Unternehmen - vom Kameramann über Postproduktion, Kopierwerk bis hin zum Kino und der TV-Sendeanstalt. Am Ende dieser Kette steht der Verbraucher (Zuschauer), der den Film dann bestenfalls so genießen soll, wie es sich Produzent und Regisseur vorgestellt haben.
Helligkeits-Farbigkeits-Farbmodelle
Was für den einen Betrachter ein sattgrüner Rasen ist, bedeutet für einen anderen Menschen knalliges „Giftgrün“ oder vielleicht sogar nur die Farbe, die er als solche definiert. Die menschliche Wahrnehmung kennt nur Zirka-Werte, individuelle Empfindungen, vage Schätzungen. Erst durch die Technik wird aus einem subjektiven Farbeindruck eine messbare Größe, die für eine einheitliche Darstellung steht.
So wird der Farbeindruck eines Videobildes durch die Chrominanz bestimmt. Alte Schwarz/Weiß-Monitore wurden früher auch als monochrom (einfarbig) bezeichnet. Im Umkehrschluss bedeutet Chrominanz nichts anderes als Farbheit. Dabei handelt es sich um konkrete Werte für die Farbsättigung und den Farbton. Neben dem Signal mit Informationen über die Farbart (Chrominanz-Signal) wird parallel das Signal für die Helligkeit (Luminanz-Signal) übertragen.
Wie bei der menschlichen Wahrnehmung wird auch in allen Fernseh- und Videosystemen die Farbinformation über das Chrominanz-Signal mit reduzierter Bandbreite gegenüber der Luminanz übertragen, da wir eben Helligkeit besser wahrnehmen als Farbe. Erst beide Signale gemeinsam liefern umfassende Informationen über das Farbbild im sogenannten Helligkeits-Farbigkeits-Modell. Allerdings würde ein einziges Farbsignal allenfalls für Hunde oder ähnliche Säugetiere ausreichen, währenddessen Insekten in der Regel die Farbe auch in anderen Frequenzen wahrnehmen. Hier müssten weitere Chrominanz-Signale hinzukommen. Der Farbraum der menschlichen Wahrnehmung entspricht vielmehr einer Fläche. Deshalb muss die Übertragung einer vollständigen Farbinformation mit mindestens zwei voneinander unabhängigen Chrominanz-Signalen erfolgen (YUV-Farbmodell).
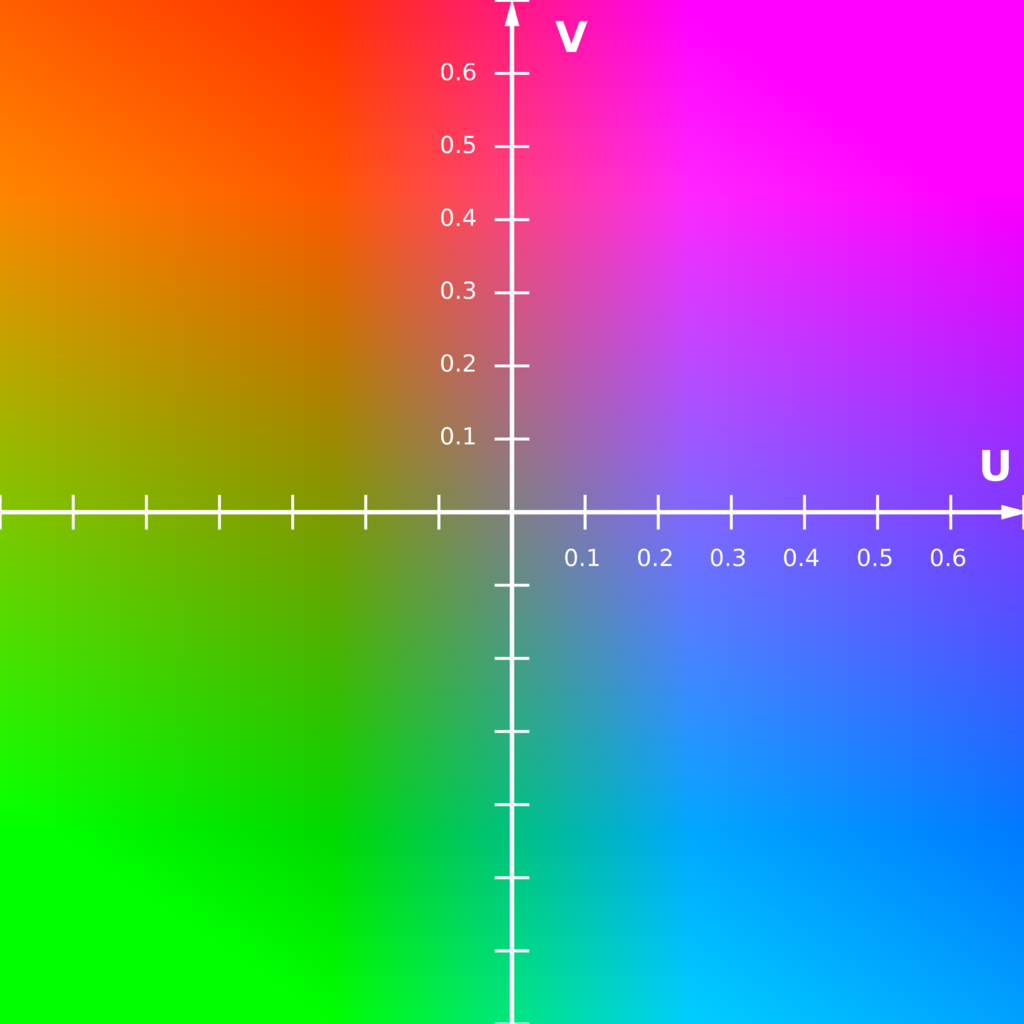
Chrominanz-Signal/YUV-Farbmodell
Beim analogen als auch beim digitalen Farbfernsehen, bei der Videoübertragung oder in der Farbfotografie – überall finden diese Chrominanz-Signale ihre Anwendung. Dabei steht „Y“ immer für das Helligkeits-Signal gemäß des CIE-Normvalenzsystems, welches der Hellempfindlichkeit des Auges entspricht, die im grünen Spektralbereich am größten ist (V-Lambda-Kurve17). CbCr steht für die beiden Chrominanz-Signale: Cb (Blue-Yellow) und Cr (Red-Green).
Allerdings ergeben sich – je nach Anwendung – unterschiedliche Bezeichnungen. So gab es bis in die 1970er Jahre beispielsweise das analoge YIQ-Farbmodell, das dem YUV-Farbmodell sehr ähnlich ist: I (Cyan-Orange) und Q (Magenta-Grün). Die Farbebene ist hier um 33° im Uhrzeigersinn gedreht. Das YIQ-Farbmodell wurde seinerzeit ausschließlich für das analoge NTSC-Fernsehen im US-amerikanischen Raum entwickelt, findet allerdings heute keine Verwendung mehr, da sich auch hier für das YUV-Farbmodell entschieden wurde. Ähnlich verhält es sich mit dem YDbDr-Farbmodell. Zu den wichtigsten zählen deshalb das digitale YCbCr, sein analoges Gegenstück sowie das YPbPr-Farbmodell, welches für die analoge Übertragung von Videosignalen aus digitalen YCbCr-farbkodierten Quellen verwendet wird. Die folgende Abbildung zeigt alle Helligkeits-Farbigkeits-Farbmodelle auf einen Blick.
|
Farbmodell |
Anwendung |
Normen, Standards, Geräte |
|
YUV |
analog |
|
|
digital |
PAL/NTSC und CCIR-601-Standard JPEG, MPEG/DVB, DVD, CD |
|
|
analog |
per Component-Video-Anschluss DVD/DVB Videorekorder, Spielkonsolen, Flachbildschirme |
|
|
analog |
ausschließlich für SECAM |
|
|
YIQ |
analog |
ausschließlich für NTSC (bis 1970er Jahre) |
Helligkeits-Farbigkeits-Farbmodelle
Photometrische Größen und Einheiten
Absolute Helligkeit, Beleuchtungsstärke, Brillanz der Strahlung, Lichtmenge, Lichtstrom, spezifische Ausstrahlung, Weißgrad … all das sind Begriffe im Zusammenhang mit dem Licht. Wie für die Farbwahrnehmung mussten auch für die Helligkeitswahrnehmung einheitliche Größen und Einheiten gefunden werden, deren Basis von jeher die Lichtstärke war.
Die internationale Beleuchtungskommission (CIE) legte vor der physiologisch erstellten Farbkennzeichnung (Normvalenzsystem/CIE 1931) auch einheitliche Werte zur Lichtmessung fest (1924). Dazu wurde in einem ähnlichen Beobachter-Verfahren der sogenannte Hellempfindlichkeitsgrad V(λ) definiert, der den objektiven Vergleich einer Lichtquelle – unabhängig vom subjektiven Sinneseindruck und den sich verändernden Umfeldbedingungen – ermöglicht. Allerdings erfolgte erst im Jahre 1972 die Empfehlung zur Anwendung durch das Internationalen Komitee für Maß und Gewicht (CIPM).
Fast ebenso lange dauerte die Bestätigung des spektralen Hellempfindlichkeitsgrades V'(λ) für das skotopische Sehen mit dunkeladaptiertem Auge, das allgemeinhin als Nachtsehen bekannt ist. Während die CIE die Normwerte bereits Anfang der 1950er Jahre veröffentlichte, wurden sie erst im Jahre 1976 von der CIPM bestätigt.
Auf der 9. Generalkonferenz für Maß und Gewicht (CGPM) wurde im Jahre 1948 die Lichtstärke einheitlich definiert und die genormte Bezeichnung Candela (lat.: Kerze) beschlossen. Dieser Name war bereits seit Mitte des 18. Jahrhunderts geläufig, ging er doch auf Versuche zurück, die mit Kerzen durchgeführt wurden, der bis dato einzigen relativ konstanten künstlichen Lichtquelle. Daraus begründen sich die heutigen photometrischen Größen und Einheiten zur Messung von Lichtintensitäten beziehungsweise der Helligkeit:
|
Größe |
SI-Einheit |
Definition |
|
Lichtstrom φv |
Lumen (lm) |
Strahlungsleistung einer Lichtquelle |
|
Lichtmenge Qv |
Lumensekunde (lms) |
Strahlungsenergie einer Lichtquelle |
|
Lichtstärke Iv |
Candela (cd) |
Lichtstrom pro Raumwinkel |
|
Leuchtdichte Lv |
Candela pro Quadratmeter (cd/m²) |
Lichtstärke einer Lichtquelle |
|
Beleuchtungsstärke Ev |
Lux (lx) |
Lichtstrom pro beleuchtete Fläche |
|
spezifische Lichtausstrahlung Mv |
Lux (lx) |
emittierter Lichtstrom |
|
Der an jedes Symbol angehängte Index v bedeutet: visuell = sichtbares Licht im Spektrum 380 bis 780 nm |
||
Photometrische Größen und Einheiten
Farbtemperatur
Die umgangssprachlich synonym verwendeten Begrifflichkeiten in Bezug auf kalte und warme Farbtöne haben nichts mit dem Maß zur quantitativen Bestimmung des jeweiligen Farbeindrucks einer Lichtquelle zu tun. Auch die Parallelen zum Wasserhahn, bei dem die Farbe Blau für kalt und Rot für warm steht, sind hier fehl am Platz. Die physikalisch definierte Eigenschaft der Oberfläche einer Lichtquelle bestimmt ausnahmslos die in diesem Kontext gemeinte Farbtemperatur. Dabei wird grundsätzlich zwischen künstlichen Lichtquellen und dem Tageslicht unterschieden (vgl. dazu Kapitel „Farbwahrnehmung“). Vereinfacht ausgedrückt, entsteht Farbe, da alle angestrahlten Körper in der Regel nur eine bestimmte Menge der elektromagnetischen Wellen absorbieren.
Um die Farbtemperatur konkret definieren zu können, wurde der sogenannte „schwarze Körper“18 oder auch „plancksche Strahler“ als Ideal- beziehungsweise Referenzstrahlungsquelle entwickelt. Er ist (theoretisch) in der Lage, elektromagnetische Strahlen aller entsprechenden Wellenlängen zu absorbieren und vollständig zurückzusenden. In der praktischen Forschung im Zusammenhang mit den idealen Eigenschaften eines schwarzen Strahlers wurde beispielsweise eine berußte Oberfläche gewählt, die über einen Absorptionsgrad von ungefähr 0,96 im sichtbaren Spektralbereich verfügt. Auch die Öffnung eines Hohlraumstrahlers oder eines langen Sacklochs wurden verwendet.
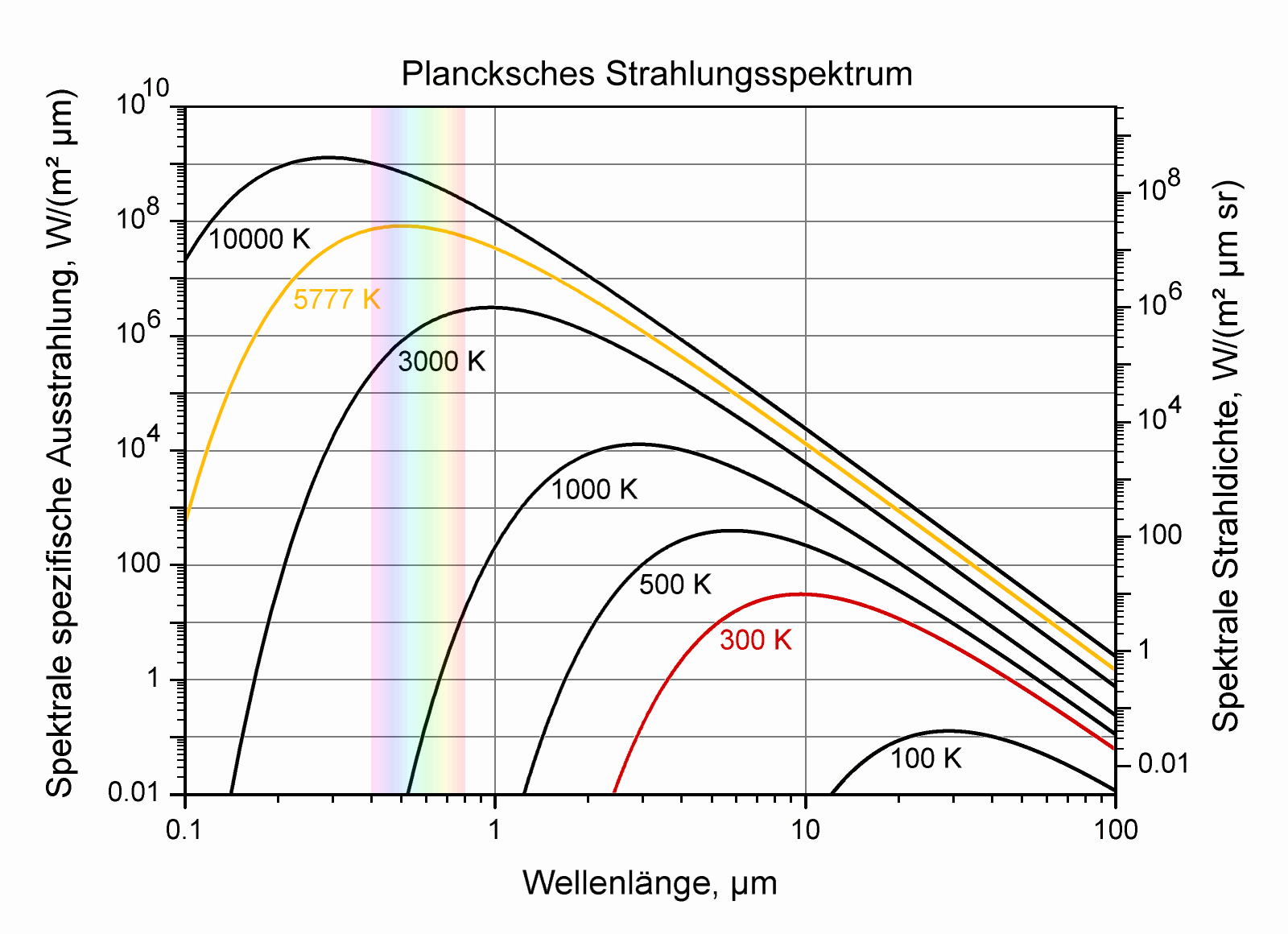
Planck‘sches Strahlungsspektrum (Wikimedia Commons)
Doch der „schwarze Körper“ bleibt ein Ideal und dient lediglich als Basis für theoretische Überlegungen (insbesondere im Bereich der Quantenphysik). Es ist bis heute nicht gelungen, einen Körper herzustellen, dessen Material elektromagnetische Wellen vollständig und frequenzunabhängig absorbieren kann.
Die Farbtemperatur wird grundsätzlich in Kelvin (K) angegeben. Dabei handelt es sich um die SI-Basiseinheit der thermodynamischen Temperatur, das heißt, mit ihr werden Temperaturdifferenzen angegeben. Neben Grad Celsius gehört Kelvin zu den gängigsten Temperatureinheiten (0 °C entsprechen 273,15 K).
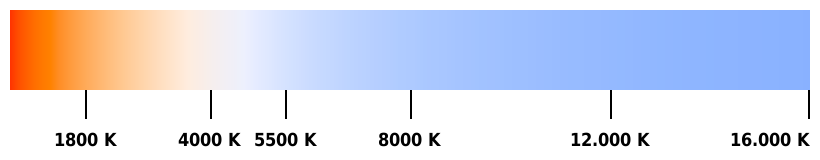
Farbtemperatur nach dem planckschen Strahlungsgesetz (Wikimedia Commons)
Das sogenannte „weiße“ Licht ist die Summe aller Wellenlängen des sichtbaren Lichtes im Frequenzbereich zwischen ca. 400 und 700 Nanometer. Je kürzer die Wellenlänge, desto höher wird die Farbtemperatur und mit ihr der Blauanteil (Abbildung 70). Der Rotanteil besteht im Gegensatz aus den längeren Wellenlängen (600 bis 700 nm). So ist also die Farbtemperatur (Kelvin) vor allem von der Wellenlänge des Lichtes beziehungsweise der Beleuchtungsquelle abhängig. Aber auch das unterschiedliche Absorptionsverhalten der einzelnen Materialien kann die Farbtemperatur beeinflussen.
In der Film- und Fernsehtechnik sollten die dargestellten Farben bestenfalls dem natürlichen Farbeindruck entsprechen. Der grüne Rasen eines Fußballfeldes sollte demnach auch tatsächlich grün und nicht braun sein, die Hautfarbe der Nachrichtensprecherin nicht an Sonnenbrand oder Blutarmut erinnern. In der folgenden Abbildung ist drei Mal dasselbe Motiv mit unterschiedlichen Farbtemperaturen dargestellt.

Vergleich der Farbtemperatur/Farbbalance
Was hier etwas übertrieben wurde, beschreibt im Grunde die Basis sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Wiedergabe von Bild- und Videomaterial in Bezug auf die Farbtemperatur. So werden bei der Bildaufnahme sogenannte Konversionsfilter vor das Kameraobjektiv gesetzt, um die Farbtemperaturen zu verändern. Denn nicht immer steht das neutrale Sonnenlicht zur Verfügung. Halogenstrahler beispielsweise geben ein gelbliches Licht ab. Um diesen Gelbstich wieder auszugleichen, müssen die Blauanteile verstärkt werden. Im Umkehrschluss kann ein blaustichiges Bild mit gelb-orangen Tönen kompensiert werden.
So, wie also Farben künstlich erzeugt werden können, kann auch das Licht beziehungsweise die von ihm bestrahlten Objekte in der Farbtemperatur verändert werden. Eine Anpassung der unterschiedlichen Farbgemische bezogen auf die unterschiedlichen Lichtverhältnisse kann mit dem sogenannten Unbunt- oder Weißabgleich durchgeführt werden. Dabei werden technische Geräte zur Bildwandlung so justiert, dass sich unabhängig von der Art und Weise der Bestrahlung bei einer weißen Bildvorlage tatsächlich die gleichen elektronischen Signale ergeben.
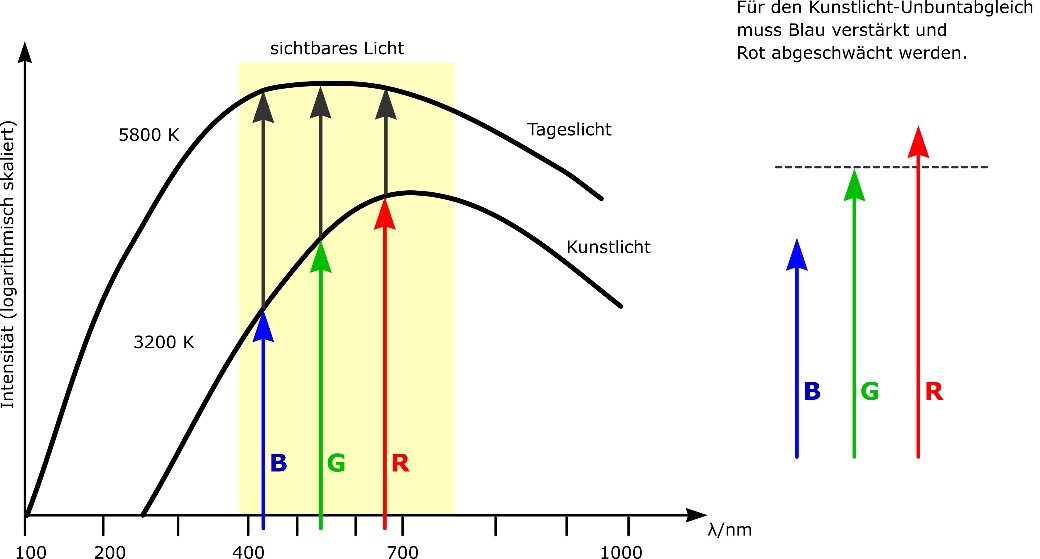
Unbuntabgleich bei Kunstlicht
Normvalenzsysteme (CIE 1931/1964)
Seit Anfang des 20. Jahrhundert befasst sich nun also die Internationale Beleuchtungskommission (Commission internationale de l’éclairage: CIE) im Wesentlichen mit der Entwicklung des XYZ-Farbraummodells, welches sich weitgehend auf dem technischen Know-how der 1920er Jahre von W. David Wright und John Guild stützt. Dennoch wird es bis heute als Messfarbraum genutzt. XYZ sind Variablen, die grundsätzlich für Rot (X), Grün (Y) und Z (Blauvalenz) stehen, deren Wellenlängen etwa Rot: 630 – 780 nm, Grün: 480 – 560 nm, Blau: 420 – 480 nm umfassen (sogar Violett ist hier darstellbar mit etwa 380 – 420 nm). Die sogenannte Farbvalenz (z.B. Blauvalenz) beschreibt die Fähigkeit, Licht in Abhängigkeit von der Wellenlänge unterschiedlich wahrzunehmen. Dadurch können verschiedene spektrale Mischungen zum gleichen Farbeindruck (Farbreiz) führen. Aus diesem Grund kann die Zusammensetzung des Farbspektrums nicht allein aus der wahrgenommenen Farbe erschlossen werden. Denn wie bereits erwähnt, ist die menschliche Farbwahrnehmung rein subjektiver Natur. Entsprechend mussten mit der Entwicklung von Farbtechnologien bestimmte Farben als Referenzwerte festgelegt werden.
Bereits im Jahre 1931 wurde eine Normfarbtafel entwickelt und von der Internationalen Beleuchtungskommission CIE) in einem Farbbeschreibungssystem definiert: dem CIE 1931. Auch heute noch stellt das CIE 1931 eine international vereinbarte Methode der Farbkennzeichnung dar, um die menschliche Farbwahrnehmung und die physiologisch farbige Wirkung einer wahrgenommenen Strahlung (Farbvalenz) in Relation zu setzen. Sie basiert auf der additiven Farbmischung. Deshalb wird dieses wahrnehmungsbezogene System auch als CIE-Normvalenzsystem bezeichnet, das die Gesamtheit aller wahrnehmbaren Farben umfasst. Im Zusammenhang mit den Farbraumkoordinaten sind auch die Bezeichnungen Yxy-Farbraum oder CIE-Yxy oder aber Tristimulus-Farbraum (im englischsprachigen Bereich) gebräuchlich.
Doch wenn Farbe lediglich eine subjektive Wahrnehmung ist, wie wurde daraus eine allgemeingültige Norm? Um eine Vereinheitlichung der Farben zu bewirken, wurden bereits in den 1920er Jahren mehrere Beobachter für die Studien hinzugezogen. Dabei wurde den Beobachtern eine vorgegebene Farbfläche mit einem Sichtfeld von 2 Grad mittig zur Hauptblickrichtung relativ dicht vor die Augen gehalten. Abgeleitet wurde diese Methode aus der Erkenntnis, dass diese Zone in etwa der höchsten Dichte der farbempfindlichen Rezeptoren im Bereich der Netzhaut entspricht. Allerdings nimmt erst ab einem Winkel von 10 Grad die Zapfendichte im Areal der besten Farbsichtigkeit im Auge ab. Deshalb wurde im Jahre 1964 auf Grundlage des erweiterten Sichtfeldes (10 Grad) das CIE(1964)-Farbsystem entwickelt, wobei die Farbfläche nicht mehr der Größe einer 1-Euro-Münze hatte, sondern der eines A4-Blattes in normalem Betrachtungsabstand von etwa 30 Zentimetern entsprach.
Diese Farbfläche bestand in beiden Versuchsreihen aus einem geteilten Schirm, auf dessen A-Seite eine bestimmte Farbe und auf dessen B-Seite drei Strahler in den Primärfarben Rot, Grün und Blau projiziert wurden, die als Maß der auf der A-Seite vorgegebenen Lichtfarbe benutzt wurden. Dabei war zwar die Helligkeit variabel, aber nicht die definierte Farbe, deren Wellenlänge mithilfe von Farbfiltern festgelegt wurde. Die Beobachter sollten ihrem subjektiven Farbempfinden nach die verschiedenen Farben, die durch Veränderungen der Helligkeitswerte der drei Lichtquellen (B-Seite) entstanden, dem jeweils vorgegebenen Farbeindruck zuordnen.
In der Entwicklungsphase zum Ende der 1920er Jahre verwendeten W. David Wright und John Guild für die Erzeugung der Spektrallinien Quecksilberdampflampen und Interferenzfilter und legten mit deren Hilfe die Farbwerte 546,1 nm (grün) und 435,8 nm (blau) fest. Da sich bei der Farbe Rot (700 nm) kleine Abweichungen der Wellenlänge im Ergebnis weit weniger bemerkbar machen, konnte auf Glühlampen mit einem Farbfilter zurückgegriffen werden. Wobei es in diesem Zusammenhang zu einem anderen Problem kam: Im Bereich der Grün-Blau-Einstellungen konnten von den Beobachtern einige Testfarben nicht vollends übereinstimmend festgelegt werden. Deshalb musste auf der einen Seite rotes Licht zugeführt und auf der anderen Seite weggenommen werden, was im Protokoll als negativer Rot-Wert festgehalten wurde.
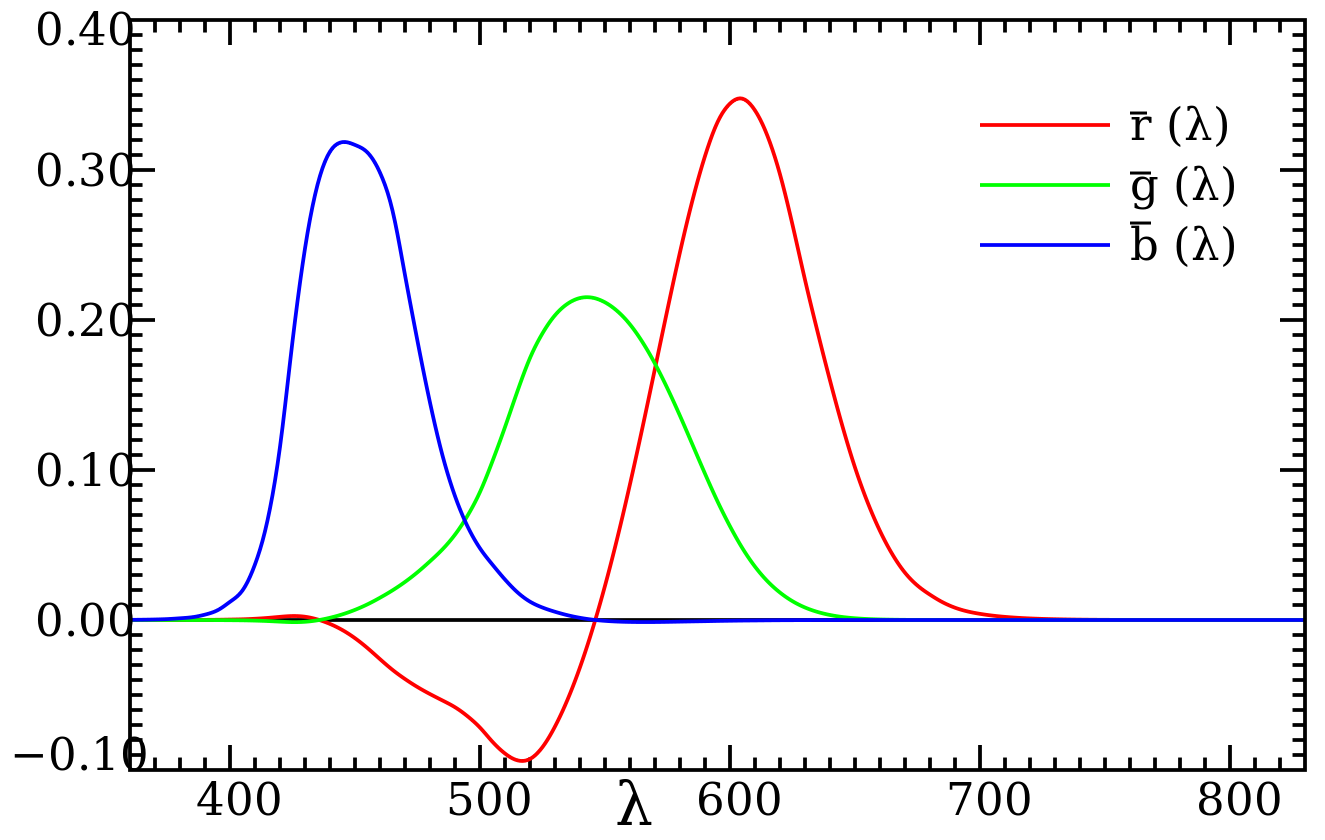
Negativer Rot-Wert
Grundsätzlich ist allerdings kein Farbdisplay oder Projektor in der Lage, rote Farbe mit negativer Intensität zu erzeugen. Deshalb können Farben im Grün-Blau-Bereich bisweilen nur ungesättigt (zu blass) dargestellt werden (Abbildung 67). Mithilfe der Dreifarbentheorie gelang somit die numerische Erfassung der vom Menschen wahrnehmbaren Farbreize. Auch wenn die Hufeisenform des CIE-Farbsegels vom Grunde her der nichtlinearen physiologischen Verarbeitung im menschlichen Auge entspricht, können mit den drei Primärfarben nur die Farbreize technisch wiedergegeben werden, die nach dem Gamut-Prinzip innerhalb des abgebildeten Dreiecks (Abbildung 81) liegen, wobei sich dieser Gamut im Laufe der Zeit vergrößerte und damit heute weitaus größere und vielfältigere Farbräume zulässt.
Farbräume und Farbmodelle
Das CIE-Normvalenzsystem stellt hingegen nur die Basis dar. In der Zwischenzeit haben sich diverse Farbräume entwickelt, die allesamt ein ganz unterschiedliches Ausmaß beinhalten. Auf dem Diagramm der folgenden Abbildung ist sehr gut zu erkennen, dass nur die drei Farbräume CIE-XYZ, CIE-RGB und Wide Gamut RGB das Farbspektrum in Richtung Violett und Rot nahezu vollständig ausschöpfen. Die Farbräume Adobe RGB, PAL/SECAM und sRGB können Farben hingegen unterhalb von 460 nm und oberhalb von 610 nm nicht mehr darstellen.
Aber was ist ein Farbraum nun eigentlich – bezogen auf technische Details und die Neuzeit? Ein Farbraum baut in der Regel auf drei Primärfarben auf. Meistens stellen diese die Eckpunkte des gewünschten Farbraums dar. Dafür werden sie an exakt festgelegten Orten positioniert, die sich innerhalb des sichtbaren Lichtspektrums befinden. Die Primärfarben sind die Ausgangsfarben (Grundfarben) eines Farbmischprozesses. Für die additive Mischung sind diese Farben Rot, Grün und Blau. Aus diesen drei Farben (RGB) lassen sich in nahezu alle beliebigen Farben mischen. Werden Rot, Grün und Blau in gleicher Helligkeit (plus maximale Sättigung) gemischt, entsteht beispielsweise 100 Prozent Weiß.
Als Sekundärfarben werden Mischungen aus zwei Primärfarben bezeichnet. So ergeben Rot + Grün = Gelb. Cyan entsteht aus Blau + Grün. Magenta entsteht aus Rot + Blau. Die Wertebereiche für Farbeindrücke von Rot, Grün und Blau sowie den Unbuntfarben (Graustufen) können unterschiedlich festgelegt werden. Üblicherweise liegen diese Werte zwischen 0 und 100 Prozent. Da die Helligkeitswahrnehmung des Menschen nicht linear ist, verläuft auch die Gammafunktion nicht linear, sondern in Form einer ansteigenden Kurve. Auf diese Weise wirkt der Helligkeitsverlauf von Schwarz zu Weiß (z.B. der Graustufenverlauf bei Grautreppe) subjektiv gleichmäßig. Die Gammakurve beschreibt den Helligkeitsanstieg zwischen 0 Prozent (Schwarz) und 100 Prozent (Weiß). Als Berechnungsgrundlage dient 100 Prozent Weiß (100 IRE). Das Weiß liegt an einem exakt definierten Ort innerhalb des Farbraums. Die Koordinaten sind x = 0,3127 und y = 0,3291 (siehe obiges Diagramm). Dieser Farbort wird auch als Weißpunkt oder D65 bezeichnet.
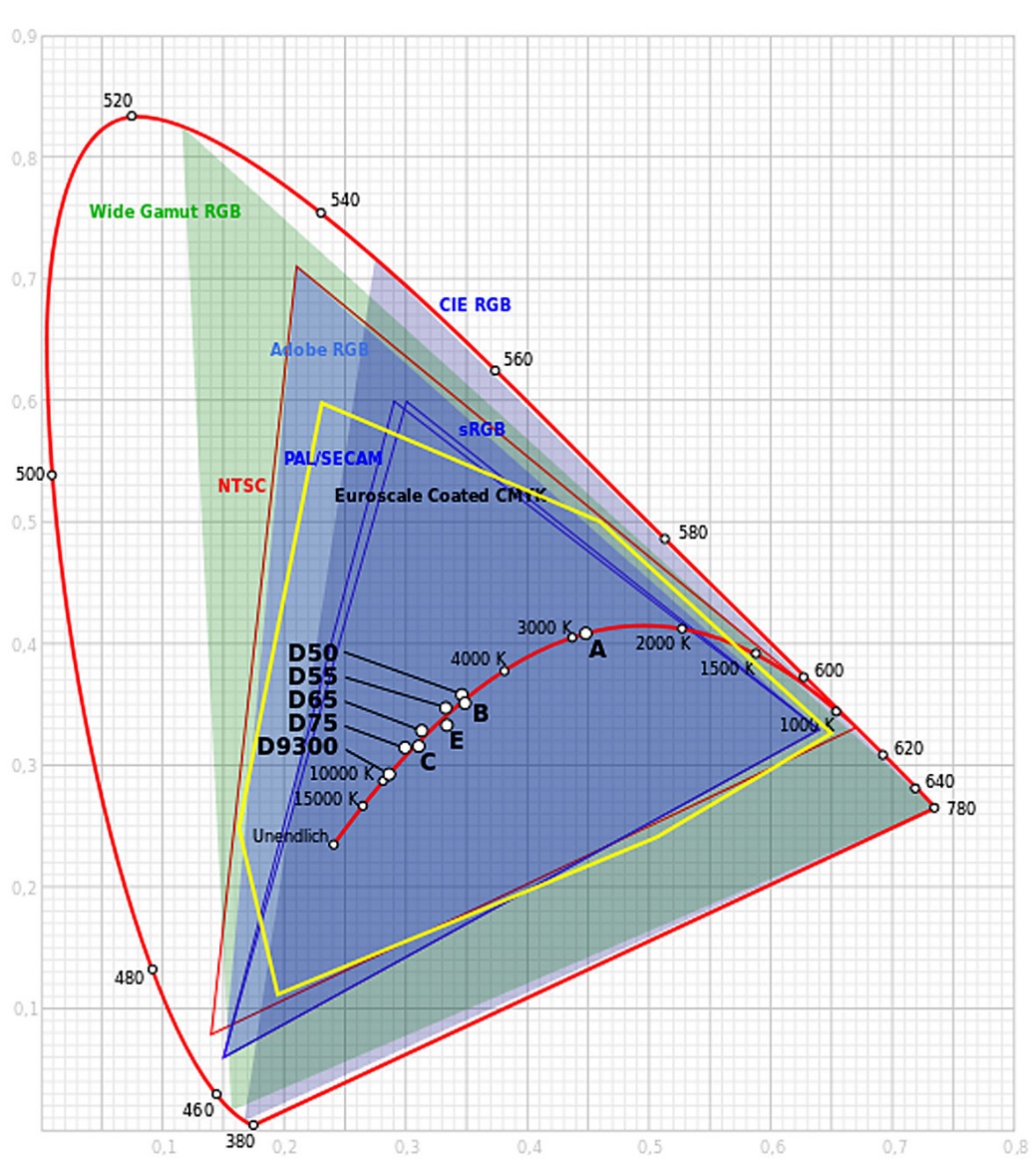
Farbraumdiagramme im Vergleich
Je nach Farbort kann eine Primärfarbe eine andere Tonalität besitzen. Wird beispielsweise Grün in Richtung Rot verschoben, kann das Grün deutlich gelber erscheinen, weil rote Spektralanteile ins grüne Farbspektrum gemischt werden. Dadurch ändert sich jede andere Mischfarbe, in die grüne Spektralanteile gemischt sind. Wird die Maximalhelligkeit oder die Sättigung von Grün verändert, hat dies ebenfalls Auswirkungen auf alle grünen Farbmischprozesse. Da unterschiedliche Farbräume (z.B. Adobe RGB und sRGB) unterschiedliche Koordinaten für die Primärfarben ausweisen, werden Farben vom selben Quellmaterial in den jeweiligen Farbräumen unterschiedlich aussehen. Pauschal kann festgehalten werden, je größer ein Farbraum ist, desto kräftiger/gesättigter/bunter können Farben erscheinen.
Wenn Quellmaterial aus einem kleineren Farbraum in einem größeren Farbraum abgebildet wird, stellt das im Allgemeinen kein Problem dar, weil der größere Farbraum die vorhanden Spektralanteile vollumfänglich darstellen kann. Umgekehrt treten naturgemäß erhebliche Probleme auf, wenn also Quellmaterial aus einem großen Farbraum in einen kleineren Farbraum konvertiert wird. Der kleinere Farbraum hat im Vergleich ein kleineres Farbspektrum. Farben, die außerhalb des Farbraums liegen, können nicht dargestellt werden. Die Folgen sind oftmals deutlich sichtbare „Falschfarben“, blasse Hauttöne und unnatürlich wirkende Landschaftsaufnahmen.
Eine Frage steht dabei natürlich im Raum: Warum gibt es heute überhaupt so viele unterschiedliche Farbräume? Die Antwort ist fast genauso umfassend wie die Fragestellung. Grundsätzlich lassen sich jedoch drei wesentliche Gründe finden:
-
verschiedene technische Bereiche (z.B. Computer, Film, Druck)
-
die technischen Bedingungen haben sich verändert und vervielfältigt
-
politische und wirtschaftliche Interessen von Unternehmen und Verbänden
Verwirrungen stiftet übrigens oft die synonyme Verwendung von Farbmodellen und Farbräumen. So wird beispielsweise das CMYK-Farbmodell im Adobe-RGB-Farbraum vornehmlich für den Offset-, Sieb- und Digitaldruck verwendet, genauso wie dessen Weiterentwicklung: der Adobe-Wide-Gamut-Farbraum, dessen Farben mithilfe des CMYK-7-Farbendrucks darstellbar sind. Das YUV-Farbmodell kennen wir aus dem Analogzeitalter des Fernsehens. Und das RGB-Farbmodell findet sich beispielsweise im sRGB-Farbraum, der im Übrigen eine Erfindung von Hewlett-Packard und Microsoft aus dem Jahre 1996 ist. Dieser wird, wird jedoch heute auch im TV-Bereich verwendet. PAL, SECAM und NTSC stehen naturgemäß für die TV-Übertragung, der Farbraum gemäß Rec.601 ist der mittlerweile veraltete Standard zur Codierung von Fernsehsignalen und DVD, Rec.709 ist die aktuelle Videonorm, Rec.2020 hingegen noch reine Theorie.
Wide Color Gamut/WCG ist wiederum keine eigentliche Farbraum-Spezifikation, sondern bezieht sich auf die Erweiterung der Hintergrundbeleuchtung in LED-Displays und die bessere Anpassung von Farbfiltern. WCG-Panels realisieren einen größeren Farbraum als Adobe-RGB, bleiben bei Grüntönen jedoch meistens zwischen sRGB und Adobe-RGB. Die folgende Auflistung soll einen kleinen Überblick über die unterschiedlichen Farbräume verschaffen:
-
CIE-XYZ: Farbraummodell (Chromatizitäts-Diagramm)
-
CIE-RGB: (auf Basis des XYZ-Modells)
-
NTSC: (vgl. Kapitel Fernsehnormen)
-
PAL: (vgl. Kapitel Fernsehnormen)
-
SECAM: (vgl. Kapitel Fernsehnormen)
-
sRGB: (Computer/Monitor seit 1996, zunehmend auch im HDTV genutzt)
-
Adobe-RGB (seit 1998 Standard in der Foto und Druck)
-
Adobe-Wide-Gamut (Weiterentwicklung des Adobe-RGB)
-
DCI (aktuelle Kino-Spezifikation im Digitalbereich)
-
Rec. 601 (alter Standard für PAL-TV, DVD, Video)
-
Rec. 709 (aktueller HDTV-Standard)
-
Rec. 2020 (zukünftiger UltraHD-Standard)
ITU-R-Empfehlung BT.709 (Rec.709)
Seit Einführung von HDTV (High Definition Television) liegt weltweit erstmals ein einheitlicher Farbstandard vor. Dieser wird mit ITU-R BT.709 für die Digitalisierung von Komponentenvideo beschrieben und nennt sich kurz BT.709 (oder Rec.709). Während BT.601 für Standard Definition Television (SDTV) und DVD spezifiziert wurde, handelt es sich bei BT.709 um den digitalen Videostandard für hochauflösendes Fernsehen HDTV sowie entsprechende DVDs und natürlich Blu-Ray-Discs. Nachdem im Jahre 1990 vorerst für HDTV mit 1.250 Zeilen spezifiziert wurde, wurde zehn Jahre später von der BTU eine Weiterentwicklung standardisiert (BT.709-4 hinzu), die HDTV mit 1.080 Zeilen (Full HD) unterstützt, die bis heute gültig ist.
Seit dem Jahre 2000 wurde mit BT.709 für das Luminanzsignal eine Abtastrate von 74,25 MHz festgeschrieben, für das Chrominanzsignal 37,125 MHZ, die Quantisierung beträgt 10 Bit und das Farb-Subsampling beträgt 4:2:2. Da es sich um einen weltweiten Standard handelt, liegen die Bildwiederholfrequenzen entsprechend bei 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz und 60 Hz, für die Wiedergabe wurde sowohl das Zeilensprungverfahren (Interlaced/1.080i) als auch das Vollbildverfahren (Progressive Scan/1.080p) festgelegt. Die Übertragung erfolgt durch das digitalisierte HDTV-Komponentensignal als HD-SDI-Signal (High Definition Serial Digital Interface).
Darüber hinaus wurde in der aktuellen BT.709 auch der Farbraum definiert, welcher innerhalb des CIE-Farbraums liegt und mit festgelegten Farbkoordinaten für Rot, Grün und Blau spezifiziert ist. Jedoch hat dieser Standard seine Lücken. In aller Regel sind Farbräume exakt spezifiziert (vgl. Kapitel „Farbräume und Farbmodelle). Leider trifft das auf Rec.709 nicht vollumfänglich zu. Während die Koordinaten für die Farborte exakt beschrieben sind, wird ein verbindlicher Gammaverlauf nur für die Filmaufnahme genannt – nicht aber für die Wiedergabe. Allgemein hat sich bei TV-Herstellern, Testmagazinen, Heimkinofreunden und Händlern ein linearer Gammaverlauf von 2,2 als „Standard“ durchgesetzt. Displays werden zwischen 10 und 90 IRE exakt auf ein Gamma 2,2 kalibriert (vgl. Kapitel „Gamma-Korrektur“ in diesem Buch).
Beim Mastering von Filmen ergibt sich nun ein Problem. Der spezifizierte Gammaverlauf von Rec.709 für die Aufnahme weicht massiv von einem realen Gamma 2,2 ab. Sollte beim Mastering einer Blu-ray-Disc das „korrespondierende Gamma“ Rec.709 genutzt werden, führt dies bei der Wiedergabe zu massiv absaufenden Details in dunklen Filmszenen, wenn das Display ein Gamma 2,2 anwendet. Leider lässt sich vorab kaum sagen, welcher Film wie gemastert worden ist.
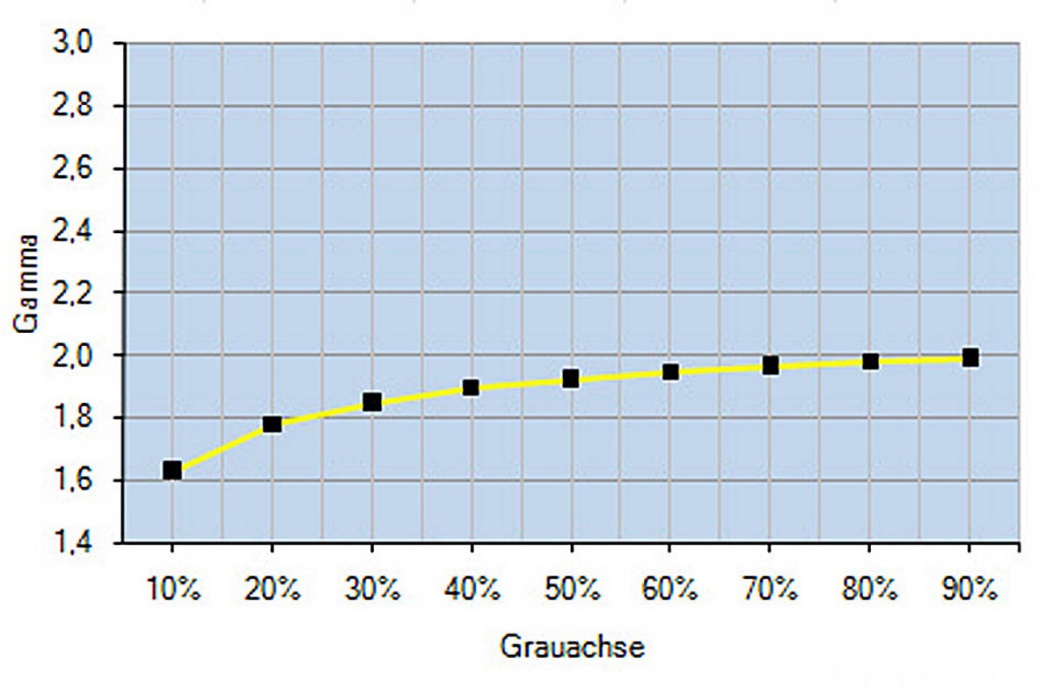
Das Diagramm in der Abbildung zeigt auf, dass Rec.709 bei 10 IRE ein Gamma 1,6 und bei 20 IRE ein Gamma 1,8 vorsieht. Das korrespondierende Gamma erzielt zu keinem Zeitpunkt den von der Industrie und Testmagazinen genutzten Wert 2,2.
Ähnlich wie bei unseren Hinweisen zur richtigen Zuspielung der BUROSCH-Referenz TV Testbilder, gewährleistet generell nur der passende Farbraum ein richtiges Bild. Wer auf die korrekte Farbreproduktion großen Wert legt, sollte das Quellmaterial in dem jeweiligen Farbraum wiedergeben, sofern dieser bekannt und einstellbar ist. So sollten US-amerikanische DVDs im entsprechenden NTSC-Farbraum abgespielt werden, europäische DVDs im Farbraum gemäß Rec.601 und eine Blu-ray mit dem Farbraum nach Rec.709.
Dafür ist es allerdings zwingend erforderlich, dass entsprechende Einstellungen im Display überhaupt möglich sind. Die meisten Fernseher und Beamer verfügen heutzutage über mehrere Optionen bezüglich der Farbräume, die auf Wunsch ausgewählt und genutzt werden können. Oftmals verbergen sie sich hinter nichtssagende Bezeichnungen, wie Farbraum „Standard“ oder „erweitert“. Im Idealfall werden diese Begriffe in der Bedienungsanleitung erläutert.
Sollte ein Display über ein vollumfängliches Farbmanagement (CMS) verfügen, können die gewünschten Farbräume auch selbst eingestellt werden. Die bereits vorhandenen Farbräume können wunschgemäß kalibriert werden, wofür jedoch externes Messequipment erforderlich wird, konkret sind das zumindest ein guter Sensor und entsprechende Software. Displays aus dem Profibereich (z.B. digitale Kinoprojektoren) sind oftmals einfacher zu bedienen. Hier brauchen meist nur die Koordinaten für die Grundfarben eingegeben zu werden. Ohne Messequipment ist es aber auch hier praktisch unmöglich, das Ergebnis zu kontrollieren.
Für die praktische Heimanwendung ist die Kalibrierung mit Messgeräten weniger attraktiv, dennoch sollen im Folgenden einige wissenswerte Dinge über den Farbraum erklärt werden. Denn in unserer digitalen Welt dreht sich heutzutage Vieles um Begriffe, wie Ultra than Black, Whiter than White, Rec.709 und Rec.2020.
Die Basis der digitalen HDTV-Chrominanz- und Luminanz-Wiedergabe ist nach wie vor die Norm Rec.709 mit dem entsprechenden Farbraum, der sich im Normvalenzsystem CIE-1931 wiederfindet und nach dem rote, grüne und blaue Pixel grundsätzlich jeweils einzeln und auch im additiven Mischungsverhältnis zueinander in 256 Abstufungen leuchten. Durch die additive Farbmischung der Primärfarben Rot, Grün und Blau (RGB) werden die Sekundärfarben Gelb, Cyan und Magenta gebildet. 8-Bit-RGB bedeutet also eine maximale Auflösung von 256 Farbabstufungen. RGB 0 ist die Definition für das dunkelste Schwarz und RGB 255 bedeutet das maximale Weiß. Alle Werte dazwischen drücken das Mischungsverhältnis beziehungsweise die Intensität der einzelnen Farben aus. Eine bestimmte Farbe kann somit als "R50, G43, B214" definiert werden. Das mittlere Grau ist beispielsweise "RGB 127".
Alle Fernsehfilme werden grundsätzlich im "normalen“ Farbraum RGB 16 bis 235 aufgenommen, geschnitten und genauso zum Verbraucher übertragen. Die Filme auf DVD und Blu-ray Disks sind ebenfalls im Farbraum RGB 16 bis 235 als Komponentensignal 4:2:2 abgespeichert. Beim Fernseher findet sich dieser Farbraum ausschließlich via HDMI (Filmwiedergabe), der USB-Eingang für die Fotowiedergabe arbeitet hier hingegen im sogenannten Extended-Farbraum RGB 0 bis 255. Vor diesem Hintergrund kommt es nicht selten zu Verwirrungen und Abweichungen in der Darstellung der BUROSCH-Testbilder. Der Grund dafür liegt darin, dass im Extended-Farbraum bei 0 der tiefste Schwarzwert und bei 255 der hellste Wert liegen, hingegen bei der Filmwiedergabe via HDMI der dunkelste Wert bei 16 und der hellste bei 235 zu finden ist.
Darüber hinaus sind gerade seit dem Jahr 2016 die ersten Fernseher auf dem Markt, die in ihrem Menü bereits die Option „Rec.2020“ anbieten. Gemeint ist damit zumeist lediglich der entsprechende Farbraum, was so aber nicht richtig ist. Auch über Rec.2020 wird viel im Internet geschrieben, nicht alles davon sollte man glauben.
ITU-R-Empfehlung BT.2020 (Rec.2020)
Die Internationale Fernmeldeunion (ITU) veröffentlichte im August 2012 auf ihrer Website die ITU-R-Empfehlung BT.2020, die im Allgemeinen unter den Kürzeln Rec.2020 oder BT.2020 bekannt ist. In der Rec.2020 sind alle für UHDTV wichtigen Aspekte definiert. Hierzu gehören die Bildschirmauflösung, Bildfrequenz, Farbunterabtastung, Farbtiefe sowie der Farbraum. Im Vergleich zur Rec.709 für HDTV fordert der UHDTV-Standard einen größeren Farbraum als bisher und darüber hinaus eine Farbtiefe von entweder 10 oder 12 Bits pro Abtastwert.
Tatsächlich wurden aber bei der Einführung von UHD-Fernsehern noch 8-Bit-Displays verwendet und somit lediglich der Farbraum nach Rec.709 genutzt. Insofern sind hier die gravierenden Unterschiede in der Bilddarstellung begründet, weshalb die Pixelanzahl eben nicht allein über die Qualität entscheidet. So wurde beispielsweise der Farbraum gemäß der Empfehlung Rec.2020 für UHD-1/UHD-2 erweitert und umfasst nunmehr 75,8 Prozent der Farben im Diagramm des Farbraumes CIE 1931 und damit Wellenlängen, die nach Rec.709 (35,9 Prozent) noch nicht darstellbar waren. Für die RGB-Grundfarben wurden die folgenden Wellenlängen nach Rec.2020 festgesetzt: Rot (630 nm), Grün (532 nm), Blau (467 nm).
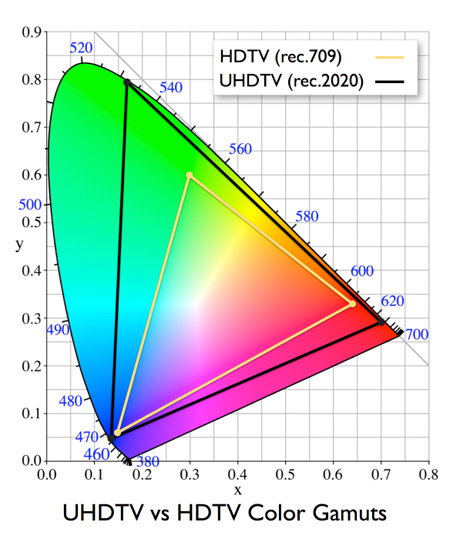
Vergleich der Farbräume nach Rec.709 (HD) und Rec.2020 (UHD)
Aufgrund der höheren Abstände zwischen benachbarten Farbwerten erfordert die entsprechend höhere Farbpräzision ein zusätzliches Bit pro Abtastwert. Gemäß der ITU-R-Empfehlung BT.2020 wird bei 10 Bits pro Abtastwert eine Helligkeitswerteskala genutzt, bei der der Schwarzpunkt auf den Code 64 und der Weißpunkt auf den Code 940 festgelegt sind. Für die Zeitreferenz dienen die Codes 0 bis 3 und 1.020 bis 1.023, während die Codes 4 bis 63 Helligkeitswerte unterhalb des Schwarzpunktes und die Codes von 941 bis 1.019 Helligkeitswerte oberhalb des Nennspitzenwertes bezeichnen. Bei 12 Bits pro Abtastwert ist der Schwarzpunkt auf dem Code 256 und der Weißpunkt auf dem Code 3.760 der Helligkeitswerteskala gemäß Rec.2020 festgelegt. Entsprechend verändern sich die übrigen Werte: Zeitreferenz (Codes 0 bis 15 und 4.080 bis 4.095), Helligkeitswerte unterhalb des Schwarzpunktes (Codes 16 bis 255), Helligkeitswerte oberhalb des Nennspitzenwertes (Codes von 3.761 bis 4.079).
Die Rec.2020 legt außerdem den sogenannten Luma-Koeffizienten fest und erlaubt RGB- und YCbCr-Signalformate mit verschiedenen Farbunterabtastungen (4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0). Dabei darf RGB verwendet werden, wenn hohe Qualität erforderlich ist, für die Kompatibilität zu SDTV/HDTV wird YCbCr empfohlen und damit Farbunterabtastung ermöglicht. Neben YCbCr lässt die Empfehlung auch eine linear kodierte Version der Luma- und Chroma-Komponenten zu. Diese wird als YcCbcCrc bezeichnet und kann zum Einsatz kommen, wenn vorrangig ein originalgetreuer Erhalt der Helligkeitsinformationen benötigt wird.
Darüber hinaus gibt die Empfehlung zwei Bildschirmauflösungen vor. Zum einen die 4K-Auflösung (UHD-1) mit 3840 × 2160 Pixeln und die 8K-Auflösung (UHD-2) mit 7680 × 4320 Bildpunkten, die quadratisch sind und ein Seitenverhältnis von 16:9 aufweisen müssen. Gemäß ITU-R-Empfehlung BT.2020 ist ausschließlich das Vollbildverfahren erlaubt, wobei folgende Bildfrequenzen spezifiziert sind: 120p, 119,88p, 100p, 60p, 59,94p, 50p, 30p, 29,97p, 25p, 24p, 23,976p. Die vollständige Umsetzung der ITU-R-Empfehlung erfolgt dann in Phase 2 mit Einführung des 8K-Standards.
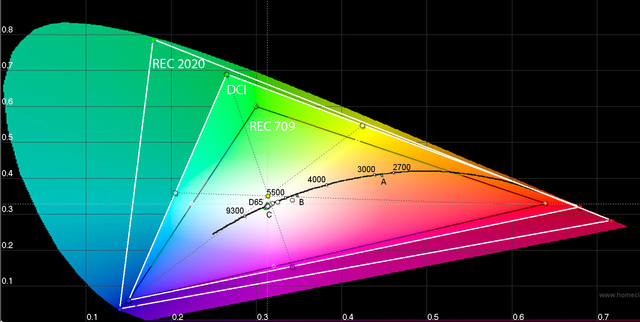
Farbräume Rec.2020, DCI und Rec.709
Weitere Features hierfür sind neben dem Rec.2020-Farbraum eine Erhöhung der Bildwiederholungsfrequenz auf maximal 120 Hz, eine Farb-Quantisierung von 10 Bit oder 12 Bit mit 4:2:2-Farbunterabtastung (HD: 4:2:0) sowie eine Erweiterung auf maximal 22.2-Kanal-Ton. Beim Ton wird sich Digital Atmos weiter im Heimvideobereich etablieren und den von der Rec.2020 empfohlenen dreidimensionalen Sound (neun Lautsprecher von oben, zehn auf Ohrhöhe, drei von unten und zwei für Effekte im Bass-Bereich) entsprechend umsetzen.
Neben der Empfehlung für 4K bzw. 8K-Auflösungen ist noch ein weiterer Farbdynamik-Standard zulässig, der bisher vorwiegend in der digitalen Kinoprojektion verwendet wurde. Es verblüfft insofern nicht, dass dieser Standard vom Dachverband der amerikanischen Filmstudios herausgegeben wurde – genauer gesagt der Digital Cinema Initiatives (DCI). Der entsprechend bezeichnete DCI-Farbraum ähnelt vom Umfang her in etwa dem Adobe-RGB-Farbraum und ist somit bedeutend größer als der Farbraum gemäß Rec.709 aber kleiner als nach Rec.2020. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass sich die 4K-Auflösung ursprünglich auf die Kino-Auflösung (4096 × 2160 Pixel) bezog, jedoch ähnlich wie DCI nunmehr in abgewandelter Form auch im Heimkinobereich Anwendung findet. Generell geht die große Farbraumdynamik gemäß ITU-R-Empfehlung BT.2020 Hand in Hand mit einer weiteren relativ neuen Technologie, die nun ebenfalls in den neuen UHD-TVs zum Einsatz kommt.
Phase 1 und 2: UHD-1 (4K)
Auflösung: 3840 x 2160 Pixel (viermal so hoch wie Full HD, deshalb auch 4K)
Seitenverhältnis: 16:9
Pixel: quadratisch, im Verhältnis von 1:1
Abtastverfahren: progressiv
Bildwiederholrate: 24, 25, 30, 50 oder 60 Hz
Farbunterabtastung: 4:2:0, 4:2:2 oder 4:4:4
Farbraum: identisch mit BT.709
Quantisierung: 10 Bit für Produktion (1024 Stufen pro Farb-/Helligkeitskanal)
8 Bit für Verteilung (256 Stufen pro Farb-/Helligkeitskanal)
Phase 3: UHD-2 (8K)
Auflösung: 7680 x 4320 Pixel (achtmal so hoch wie Full HD, deshalb auch 8K)
Seitenverhältnis: 16:9
Pixel: quadratisch, im Verhältnis von 1:1
Abtastverfahren: progressiv
Bildwiederholrate: 24, 25, 30, 50, 60, 100 oder 120 Hz
Farbunterabtastung: 4:2:0, 4:2:2 oder 4:4:4
Farbraum: erweiterter Farbraum/Wide Color Gamut (WCG)
Quantisierung: 10/12 Bit (pro Farb- und Helligkeitskanal)
Video-/Auflösungsstandards
Es gab tatsächlich einmal eine Zeit, in der man sich über Videoformate und Videoauflösungen keine Gedanken machen musste. Es gab nur das Fernsehen. Und irgendwann in den 1960er Jahren war jeder froh, wenn er überhaupt einen solchen Apparat sein Eigen nennen durfte. Diese Zeit ist allerdings endgültig vorbei. Im Zuge der sich immer rasanter entwickelnden Bildschirmgrößen – parallel zum Anspruchsverhalten der Verbraucher – schossen Begriffe wie HD, Full HD, Ultra HD sowie 4K und 8K aus dem multimedialen Boden wie Pilze. Hier soll nun kurz umrissen werden, was es im Einzelnen damit auf sich hat.

Verschiedene Videoformate und ihre Auflösungen
Standard Definition (SD)
Das digitale Pendant und quasi der Vorläufer des hochauflösenden Digitalfernsehens ist das sogenannte Standard Definition Television (SDTV). Dieser Standard ist mehr oder minder ein Sammelbegriff für überwiegend digitale Videoauflösungen – allerdings gegenüber High Definition Television (HDTV) von nur durchschnittlicher Qualität. Tatsächlich ist SDTV derzeit immer noch die digitale Standardvariante, jedenfalls solange HDTV noch nicht vollständig und bestenfalls unverschlüsselt gesendet wird. Deshalb sind bis heute (Stand: 2016) beide Auflösungsvarianten (mitunter parallel) vorhanden.
Im Rahmen der Digitalisierung des Fernsehens wurden zunächst die damals gängigen Standards für die Bildauflösung 720 x 576 beziehungsweise 720 x 480 Pixel eingesetzt. Die im Zusammenhang mit HDTV verwendeten Bezeichnungen 576i und 480i lassen im Übrigen ausschließlich auf die vertikale Auflösung beziehungsweise die Anzahl der Bildzeilen schließen: 576 (PAL) und 480 (NTSC). Wie bereits mehrfach erwähnt, bezieht sich dabei das „i“ auf den verwendeten Bildübertragungsmodus – in diesem Fall das Zeilensprungverfahren (Interlace). Grundsätzlich kann SDTV aber mit beiden Darstellungsmethoden arbeiten, also auch mit dem Vollbildverfahren Progressive Scan (z.B. 1080p oder 720p). Die horizontale Auflösung wird hingegen durch das jeweilige Bildformat (z.B. 4:3 oder 16:9) definiert.
High Definition (HDTV)
Nicht selten wird dieser Begriff falsch verwendet. Seit zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Digitalisierung Einzug hielt, wurde mit Begriffen wie „HD ready“, „HDTV“ oder „1080p“ nur so um sich geworfen. Kaum jemand verstand, was wirklich dahintersteckte. Heute – im Zeitalter von Ultra HD – wird die Schlagzahl der Begriffe höher und parallel nicht selten auch die Verwirrung.
High Definition Television (HDTV) ist ein Sammelbegriff für hochauflösendes Fernsehen. Darunter zählt sowohl Full HD als auch Ultra HD, das Gegenteil beziehungsweise der Vorgänger ist SDTV. Der Unterschied liegt ausschließlich in der höheren vertikalen (Bildzeilen), horizontalen (Bildübertragung) sowie temporalen (Bilder pro Sekunde) Auflösung, also in der Anzahl der Pixel und der Bildwiederholungsrate. HDTV hat als solches nichts mit dem Verfahren der Wiedergabe oder aber dem Bildformat zu tun, obwohl sich hier zumindest für den TV-Bereich 16:9 etabliert hat. Oft synonym für HDTV wird der Begriff „1080p“ verwendet und das „p“ fälschlicherweise als „Pixel“ definiert. Dieser bezieht sich jedoch auf die Anzahl der Bildzeilen und das Vollbildverfahren (Progressive Scan). Insofern verbergen sich hinter „1080i“ das Zeilensprungverfahren (Interlaced) sowie ebenfalls 1080 Bildzeilen in der vertikalen Auflösung.
Da HDTV weitaus mehr Parameter in punkto Bildauflösung und Bildwechselfrequenz beziehungsweise Bildwiederholungsrate zu bieten hat, sollten diese Daten unterschieden werden. Grundsätzlich gibt man die Qualität der Signalverarbeitung in Zeilenzahl + Bildverfahren + Bildwechselfrequenz an, wobei die Zeilenzahl Auskunft über die vertikale Bildauflösung gibt, die in Pixel angegeben wird. Bei der Bildwiederholungsrate wird es bisweilen noch verrückter. Grundsätzlich wird diese pro Sekunde angegeben, die Frequenz als solche in Hz. Nicht selten wird aber die Einheit mit der Bezeichnung verwechselt, zumal es hier gleich mehrere Schreibweisen gibt: Bilder pro Sekunde/frames per second/BpS oder eben fps. Hinzu kommt, dass das Vollbildverfahren auch als Progressive Segmented Frame bezeichnet wird und das Kürzel PsF verwendet.
Gemäß Nomenklatur (also der definierten Bezeichnung) der European Broadcasting Union (EBU) beinhaltet die offizielle Schreibweise die Angabe der effektiven Vollbilder pro Sekunde (beim Halbbild- oder Zeilensprungverfahren entsprechend die Hälfte der übertragenen Bilder), also beispielsweise 720p/50 oder 1080i/25). Gemeint sind also:
720 Bildzeilen/Progressive Scan/50 Vollbilder pro Sekunde
1080 Bildzeilen/Interlaced/25 Vollbilder (50 Halbbilder) pro Sekunde.
Digitale Kinoproduktionen werden mit 24p oder 1080p24 tituliert. Hier werden nur 24 Bilder pro Sekunde im Vollbildverfahren übertragen. Jedoch nicht immer mit nur 1080 Bildzeilen, weshalb im ultrahochauflösenden 4K-Cinema-Bereich auch die Bezeichnung „4K@24p“ möglich ist.
Die Befürworter von 720p und die von 1080i sind sich einig, dass 1080p das Ziel sein sollte. Damit ist aber 1080p mit 50 Bildern pro Sekunde gemeint (in den USA und Japan mit 60 Hertz). Die Untersuchungen der EBU haben gezeigt, dass selbst mit heutiger Technik die Ausstrahlung von 1080p/50 machbar wäre, da sich die Datenraten gegenüber 1080i nur geringfügig erhöhen. Der Grund liegt in der günstigeren Codier-Effizienz von Progressive-Formaten. Allerdings verarbeiten derzeit die wenigsten Empfänger 1080p.
Full HD (1920 × 1080 Pixel)
Mit der Bezeichnung Full HD wird zum einen die HD-Auflösung 1920 × 1080 Pixeln (2.073.600 Pixel), zum anderen in der Praxis aber vielmehr die Leistungseigenschaft des jeweiligen HD-Gerätes (z.B. Fernseher, Bildschirme, Smartphones) gemeint. Wobei seinerzeit mit der Bezeichnung „Full“ (vollständig) eigentlich – jedenfalls sprachlich – kaum noch Spielraum nach oben gelassen wurde. Dennoch entstand relativ schnell ein Nachfolger. In der folgenden Abbildung werden die Standards Full HD und der zukünftige Standard für Ultra HD (UHD-2) verglichen (vgl. Kapitel „Rec.2020“ in diesem Buch von Klaus Burosch).
|
Parameter |
Full HD |
UHD-2 (8K) |
|
Definition (Pixel) |
1920 x 1080 (2 Mio. Pixel) |
7680 x 4320 (33 Mio. Pixel) |
|
Bildseiten-Verhältnis |
16 : 9 |
16 : 9 |
|
Bit-Tiefe |
8 bzw. 10 |
10 bzw. 12 |
|
Bildfrequenzen |
24, 25, 30 bzw. 50, 60 |
50, 60 |
|
Datenrate (unkomprimiert) |
max. 2,49 Gbit/s |
72 Gbit/s |
|
Standards |
SMPTE 274M ITU-R BT.709 |
SMPTE 2036-1 ITU-R BT.2020 |
Vergleich Full HD und UHD-2 (8K)
UHD-1: Ultra HD (3840 × 2160 Pixel)
Im Jahre 2013 stellten auf der Consumer Electronics Show diverse Hersteller Ultra HD (kurz: UHD) vor, das doppelt so hoch auflöst (3840 × 2160 Pixel), was ungefähr 8 Megapixeln entspricht. UHD-1 ist die offizielle Bezeichnung gemäß Rec.2020 (vgl. entsprechendes Kapitel), wird aber in der Praxis als Ultra HD oder UHD bezeichnet. Bei vielen Herstellern hat sich auch der Name „4K“ durchgesetzt, wobei diese Bezeichnung eigentlich aus dem Cinema-Bereich kommt und die Bildauflösung 4096 × 2160 Pixel meint. Jedoch hat sich 4K in Bezug auf die UHD-Auflösung bereits soweit etabliert, dass hier der Weg zurück nicht mehr möglich ist. Anwender sollten lediglich zwei Mal hinschauen, was tatsächlich gemeint ist. Im TV-Bereich ist in der Regel die TV-Auflösung (Ultra HD mit 3840 × 2160 Pixeln) gemeint, bei Beamern hingegen die Cinema-Auflösung (4K mit 4096 × 2160 Pixeln).
UHD-2: 8K (7680 × 4320 Pixel)
Doch das ist längst nicht das Ende der Fahnenstange. In den Startlöchern steht bereits UHD-2 gemäß Rec.2020. Gemeint ist die 8k-Auflösung, welche mit 7680 × 4320 Pixeln in Höhe und Breite jeweils vier Mal so hoch auflöst wie Full HD. Damit ist die Pixelzahl sechzehn Mal so hoch und die Datenrate umfasst 24 Gbit/s. Entsprechend leistungsstark müssen die Geräte sein. Hierzu wird im Einzelnen im Kapitel „ITU-R-Empfehlung BT.2020“ hingewiesen.
4K Cinema (4096 × 2160 Pixel)
4K steht also ebenfalls für die Videoauflösung von 4096 × 2160 Pixeln im Cinema-Bereich. Da sich beide Werte (horizontal/vertikal) auf 4000 × 2000 runden lassen, entstand hier auch die Abkürzung 4k2k, wobei sich das „k“ auf das entsprechende Vielfache der Maßeinheit Kilo (Tausend) bezieht.
Fernsehnormen
Als das Fernsehsystem erfunden wurde, reichte die Technik noch nicht aus, um progressiv arbeiten zu können. Das änderte sich erst mit der Entwicklung der aktuellen Computersysteme. Progressive Scan findet sich im digitalen Fernsehen, aber hauptsächlich in Kinofilmproduktionen und den damit bespielten Blu-ray-Discs wieder. Bei Letztgenannten ist das 1080p/24-Signal (mit 24 Vollbildern) üblich. Trotzdem wird auch im Digital-TV das Zeilensprungverfahren immer noch eingesetzt. Internationale HDTV-Sender und alle HD-Ableger der deutschsprachigen Privatsender senden im Format 1080i/50. Dagegen folgen alle deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen Sender einer Empfehlung der European Broadcasting Union (EBU) und senden im Format 720p – also progressiv.
Zurückzuführen ist die EBU-Empfehlung auf mehrere Versuchsreihen aus dem Jahre 2006, in denen die Darstellung von 720p und 1080i verglichen wurde. Dabei stellte sich heraus, dass bei gleicher Datenrate das 720p-Bild damals meistens besser bewertet wurde. Auch europäische Sender wie Arte, ORF und SRG senden in diesem Format. Nach und nach wird eine Umstellung auf 1080p erfolgen, allerdings generell 1080p mit 50 Vollbildern pro Sekunde (USA/Japan: 60 Hz). Die Untersuchungen der EBU haben gezeigt, dass die Ausstrahlung von 1080p/50 machbar wäre, da sich die Datenraten gegenüber 1080i (50 Halbbilder) nur geringfügig erhöhen. Der Grund liegt in der günstigeren Codier-Effizienz von Progressive-Formaten.
Die in Deutschland und Europa (noch) vorherrschende analoge Fernsehnorm B/G wird auch als PAL (Phase Alternating Line) bezeichnet. Hier wird generell nach dem Zeilensprungverfahren (Interlaced) gearbeitet, ein Vollbild besteht aus 625 (575 sichtbaren) Zeilen, die Halbbilder aus je 312½ (287½) Zeilen. Dabei werden 25 Voll- bzw. 50 Halbbilder pro Sekunde übertragen, was einer Frequenz von 50 Hertz entspricht. Die Bandbreite beträgt 5,5 MHz, die Farbträgerfrequenz 4,43 MHz. Grundsätzlich setzten sich drei Farbfernsehnormen durch, die in der folgenden Abbildung (51) dargestellt sind. Dabei ist klar zu erkennen, dass sich letztlich aufgrund der nicht immer zu gewährleistenden Kompatibilität die einzelnen Normen regional konzentrieren.
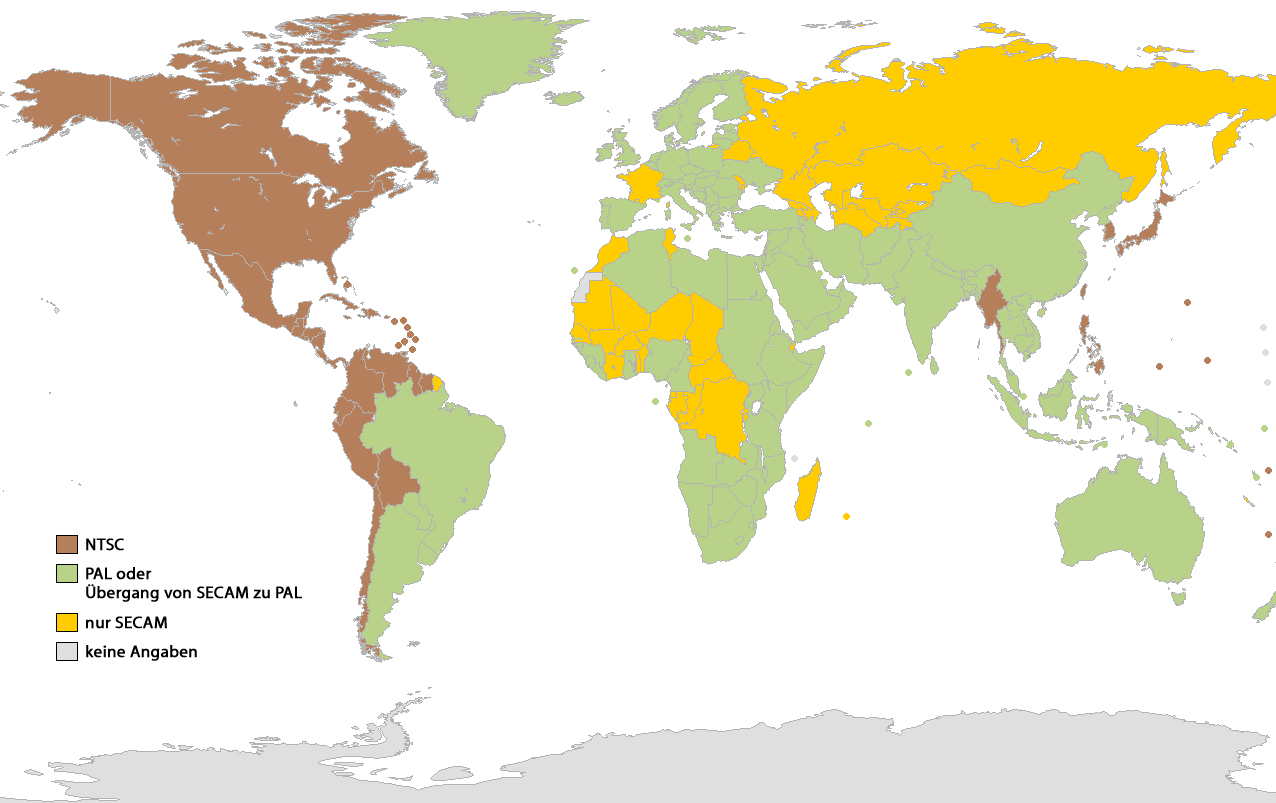
Nutzungsgebiete der einzelnen Fernsehnormen
Neben dem SECAM-Verfahren sind NTSC und PAL die bekannten Farbfernsehnormen. Sie werden oft im Zusammenhang mit den Bildaufbaustandards benutzt, um die Zeilen-/Bildanzahl (525/60 und 625/50) zu unterscheiden. Allerdings ist eine solche klare Abgrenzung nicht möglich.
Brasilien beispielsweise überträgt grundsätzlich in NTSC (525/60), verwendet für die Farbcodierung in der analogen Fernsehübertragung allerdings die PAL-Norm. Insofern bietet die Tabelle (Abbildung 52) eine kleine Übersicht über die Verwendung der einzelnen Farbfernsehsysteme, wobei diese nach und nach ihre absolute Gültigkeit im Rahmen der Digitalisierung verliert.
|
NTSC |
PAL |
SECAM |
|||
|
Bolivien |
Chile |
Ägypten |
Australien |
Frankreich |
Niger |
|
Equador |
Haiti |
Brasilien |
Deutschland |
Marokko |
Monaco |
|
Hawaii |
Japan |
China |
Großbritannien |
Mauretanien |
Senegal |
|
Kanada |
Kolumbien |
Indien |
Indonesien |
Mongolei |
Ukraine |
|
Korea |
Kuba |
Italien |
Kenia |
Russland |
|
|
Mexiko |
Philippinen |
Neuseeland |
Niederlande |
Tunesien |
|
|
Peru |
USA |
Südafrika |
Thailand |
||
Übersicht der Farbfernsehsysteme nach Ländern
Denn mittlerweile gibt es natürlich auch digitale Fernsehnormen, die sich jedoch weiterhin an den Kenndaten der analogen Fernsehnormen (z.B. Zeilenzahl und Bildfrequenz) orientieren. Ein weiteres Merkmal der digitalen Fernsehnormen ist die Anzahl der Spalten eines Bildes. Aus der Verbindung der Bildspalten und Bildzeilen entsteht die Bildauflösung in Bildpunkten (Pixel).
Zukünftig werden beim digitalen Videoformat Ultra High Definition Television (UHD TV) nur noch Vollbilder aufgenommen und wiedergegeben. Gemäß der Empfehlung der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) aus dem Jahre 2012 sind hier zwei Bildauflösungen (4K und 8K) sowie eine definierte Bildwiederholungsrate von max. 120 Vollbildern vorgesehen.
Näheres hierzu findet sich im Kapitel zur ITU-R-Empfehlung BT.2020 in diesem Buch: Medientechnik von Klaus Burosch.
